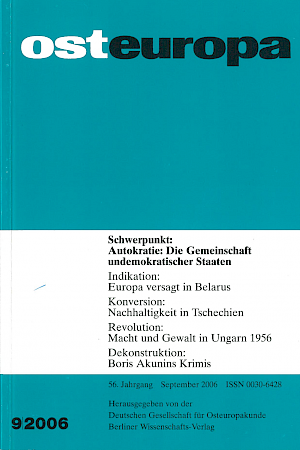Der verlorene Schatz der Revolution
Hannah Arendt und die Revolutionen 1956, 1968 und 1989
Volltext als Datei (PDF, 240 kB)
Abstract in English
Abstract
Hannah Arendt hat erstaunlich früh von der Legitimitätskrise des sowjetischen Imperiums gesprochen. Diese Weitsichtigkeit war allerdings mit einer Kurzsichtigkeit bei der Beobachtung aktueller Ereignisse im kommunistischen Osteuropa gekoppelt. Die blutigen Ereignisse des Ungarnaufstands 1956 spielte sie etwa herunter. Sie schrieb von ihnen, als habe sie das im Auge, was erst 1989 stattfand. Gleichwohl sind Arendts theoretische Erkenntnisse über das Verhältnis von Macht und Gewalt zentral für das Verständnis des Ungarischen Volksaufstandes sowie der politischen Bedeutung, welche die kollektive Erinnerung an dieses Ereignis im Jahr 1989 und bis heute hat.
(Osteuropa 9/2006, S. 85–98)
Volltext
Hannah Arendt hat erstaunlich früh von der Legitimitätskrise des sowjetischen Imperiums gesprochen. Diese Weitsichtigkeit war allerdings mit einer Kurzsichtigkeit bei der Beobachtung aktueller Ereignisse im kommunistischen Osteuropa gekoppelt. Die blutigen Ereignisse des Ungarnaufstands 1956 spielte sie etwa herunter. Sie schrieb von ihnen, als habe sie das im Auge, was erst 1989 stattfand. Gleichwohl sind Arendts theoretische Erkenntnisse über das Verhältnis von Macht und Gewalt zentral für das Verständnis des Ungarischen Volksaufstandes sowie der politischen Bedeutung, welche die kollektive Erinnerung an dieses Ereignis im Jahr 1989 und bis heute hat. Im Oktober 2006 jährte sich der ungarische Volksaufstand zum fünfzigsten Mal. Das veritable „europäische Jahr“ 1956 brachte die erste große Krise des sowjetischen Imperiums. Dies bietet Anlaß, sich mit dem Denken Hannah Arendts und ihren Einsichten in das Wesen des Totalitarismus und die Substanz des Politischen zu befassen. Obwohl Arendt nicht viel über den Volksaufstand 1956 in Ungarn und noch weniger über den Prager Frühling 1968 geschrieben hat, sind ihre Erkenntnisse über das Verhältnis von Macht und Gewalt und die Möglichkeit revolutionärer Umbrüche für beide Ereignisse wichtig. Noch mehr gilt das für das Ende des Kommunismus 1989. Ein solch unhistorisches Unternehmen, drei Ereignisse, die mehr als dreißig Jahre auseinander liegen, unter einem Blickwinkel zu betrachten, wird auf die gleichen Vorbehalte stoßen, mit denen auch Hannah Arendt konfrontiert war. Die meisten Historiker fanden ihre Darstellungen verzerrt, da sie mehr an Ideen als an „Fakten“ interessiert war. Politikwissenschaftler konnten nicht damit umgehen, daß sie sich weigerte, scharf zwischen analytischen und normativen Feststellungen, zwischen Beschreibungen dessen, „was ist“ und dem, „was sein sollte“, zu unterscheiden. Revolutionen faszinierten Arendt und beunruhigten sie zugleich. Die Faszination rührte daher, daß sich in Revolutionen das Politische in Reinform zeigt. Revolutionen waren für sie jene magischen Momente in der Menschheitsgeschichte, in denen Männer und Frauen gemeinsam handeln und so in der Lage sind, die Grenzen ihrer biologischen Existenz zu überschreiten und Idealen der Freiheit nachzustreben. Nur durch solches politisches Handeln würden, so Arendt, Menschen ihr Potential ausschöpfen. Und Revolutionen galten ihr als die entscheidenden Ereignisse der jüngeren Geschichte, weil in ihnen „der politische Bereich wieder in seiner alten Autonomie zur Geltung kam.“ Was Arendt an Revolutionen beunruhigte, war die Tatsache, daß sie nur allzuoft äußerst blutig verliefen. Und wo Gewalt im Spiel ist, gibt es wenig Raum für Politik. Dies scheint eine seltsame These zu sein, geht es in der Politik doch hauptsächlich um Konflikte, die auch gewaltsam ausgetragen werden. Hannah Arendt sah dies anders. Was den Menschen zu einem politischen Wesen mache, sei seine „Fähigkeit zu handeln und zu sprechen“, wobei „das Sprechen […] eine andere Art des Handelns“ sei. Gewalt sei hingegen „im Unterschied zur Macht stumm; Gewalt beginnt, wo das Sprechen endet.“ Daher könnten Revolutionen, die sich auf Gewalt verlassen, niemals die Voraussetzungen für Freiheit schaffen. Arendt war überzeugt, daß Macht niemals „aus den Gewehrläufen“ kommen könne. Macht und Gewalt gelten ihr als Gegensätze: „[W]o die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden.“ Revolutionäre Bewegungen, die sich die Eliminierung der Freiheit zum Ziel gesetzt hatten, untersuchte sie nicht zuletzt in ihrem bedeutenden Werk „Über die Revolution“. Eine der zentralen Einsichten Arendts, die sie in „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ darlegte, war, daß der Nationalsozialismus und der Stalinismus von totalitären Bewegungen mit radikalen revolutionären Zielen installiert wurden. Selbstverständlich sind einige Aspekte dieser klassischen Studie über den Totalitarismus nicht mehr zu halten. Wenn Arendt etwa andeutet, die Entstehung des Totalitarismus habe etwas mit der Enttäuschung des europäischen Bürgertums zu tun, das bereit war, die „heroischen“ Ziele einer totalitären Bewegung zu akzeptieren, so kann dies nicht überzeugen. Die Tatsache, daß das Bürgertum allzu oft von engen, selbstsüchtigen Interessen geleitet war, erklärt nicht, warum es der nationalsozialistischen Ideologie erlag. Zudem ist diese Erklärung nicht auf Rußland anwendbar, wo, wie Arendt bemerkte, eine atomisierte Gesellschaftsordnung erst von der totalitären Bewegung geschaffen werden mußte, statt eine Voraussetzung für ihre Entstehung zu sein. Auch Arendts Skepsis gegenüber der entstehenden internationalen Menschenrechtsbewegung scheint überholt. Schließlich ist auch ihre These, eine totalitäre Herrschaft könne nur in bevölkerungsreichen Staaten aufrechterhalten werden, durch das stabile nordkoreanische Regime widerlegt. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Wichtiger ist jedoch, wie viele der Arendtschen Erkenntnisse relevant geblieben sind, nachdem sich mit dem Zusammenbruch des Kommunismus die Archive in Rußland geöffnet haben. Das gilt etwa für die Rolle der Ideologie. Historiker der revisionistischen Schule wie Sheila Fitzpatrick hatten der Bedeutung der Ideologie keine sonderliche Bedeutung beimessen wollen. In den letzten Jahren hat sowohl die Politikgeschichte als auch die Alltagsgeschichte anhand neuen Archivmaterials zeigen können, daß Arendts Position richtig ist. „Totgesagte leben länger“ – Totalitarismus als Modell Die Kritiker des totalitären Paradigmas betonten immer wieder, daß es nicht hilfreich sei, die Geschichte aus der Perspektive heutiger politischer Ansichten zu betrachten und zu beurteilen. So bemühten sich revisionistische Osteuropahistoriker seit den 1970er Jahren, ihre Forschung aus dem Kreuzfeuer der vom Kalten Krieg angeheizten Auseinandersetzung zu nehmen, indem sie sich auf Gesellschaftsgeschichte und später auf die Alltagsgeschichte konzentrierten. Sie wollten wissen, wie normale Menschen in unnormalen Zeiten lebten. Dabei waren sie überzeugt, bessere Erkenntnisse über die innere Dynamik der kommunistischen Regime gewinnen zu können als die Anhänger des totalitären Paradigmas. Darüber hinaus wandten sie sich strikt gegen die Behauptung, es bestünden keine fundamentalen Unterschiede zwischen dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus, zwischen dem bolschewistischen und dem nationalsozialistischen revolutionären Projekt. Diese Versuche erinnern an den Raucher, der behauptet, nichts sei leichter als das Rauchen aufzugeben – schließlich habe er das schon viele Male gemacht. Wieder und wieder wurde Totalitarismustheorie für tot oder irrelevant erklärt. Und immer wieder entstand sie mit neuer Vitalität. Wir erleben seit einigen Jahren eine „dritte Welle“ der neueren Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus. Die erste Welle ging in den 1970er und 1980er Jahren von den regimekritischen osteuropäischen Intellektuellen aus, die Hannah Arendt, Albert Camus und George Orwell entdeckten. Da ihre Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus mit dem Aufstieg der revisionistischen Sowjetunionforschung im Westen zusammenfiel, wurden sie dort weitgehend ignoriert. Die zweite Welle folgte auf den Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums 1989–1991. Nun interessierten sich fast alle westlichen Universitätsprofessoren für das Totalitarismus-Konzept. Eine gewisse Rolle spielte dabei der Einfluß ostmittel- und osteuropäischer Intellektueller auf den westeuropäischen Diskurs. Die dritte Welle löste der 11. September 2001 aus. Was schwammig als „Krieg gegen den Terror“ bezeichnet wurde, wird von vielen als Krieg gegen einen neuen Totalitarismus gedacht, der in der Ideologie des islamischen Fundamentalismus verankert sei. „Natalität“ und die Möglichkeit der Freiheit Eine andere gängige Argumentation gegen das Totalitarismus-Paradigma lautet, es würde die innere Dynamik totalitärer Regime unterschätzen, die Totalitarimus-Theorien könnten Veränderungen in totalitären Staaten nicht erfassen. Hannah Arendt war tatsächlich recht pessimistisch, als sie Ende der 1940er Jahre The Origins of Totalitarianism schrieb. Aber sie hatte dennoch die Hoffnung, daß totalitäre Gesellschaften auch von innen in Frage gestellt werden könnten. Sie war sogar überzeugt, daß totalitäre Regime nichts Bleibendes errichten können: „Totale Herrschaft gleich der Tyrannis trägt den Keim ihres Verderbens in sich.“ Ein totalitärer Staat könne die Gesellschaft nie vollständig atomisieren und absolute Kontrolle über alle Bürger erlangen. Daher könne es immer einen neuen Anfang geben, die Möglichkeit eines solchen Anfangs sei ein wesentlicher Bestandteil der conditio humana: Initium ut esset, creatus est homo – ‚damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen’, sagt Augustin. Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt eines jeden Menschen. Mit diesen Sätzen endet die 1955 – also ein Jahr vor dem Ungarischen Volksaufstand – erschienene, gegenüber dem Original erweiterte deutsche Ausgabe der Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft. Viel klarer formuliert Arendt das Konzept des Neuanfangs und seine Bedeutung für die Revolution, für die Freiheit und für das Ideal des Politischen aber in ihren späteren Schriften, in Vita Activa , Über die Revolution und in den Fragmenten, die in dem Band Was ist Politik? versammelt sind. Ebenso wie man die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft „besser von hinten als von vorn liest“ , so ist auch Arendts gesamtes Werk am besten zu verstehen, wenn man ihre früheren Arbeiten im Lichte ihrer späteren Erkenntnisse liest. Arendts Verständnis des Politischen ist entscheidend von ihrem Studium des Totalitarismus beeinflußt. Eines der Grundanliegen ihrer politischen Theorie ist die Frage, wie der politische Bereich erhalten werden kann, der einzige Ort, an dem Menschen als freie Bürger handeln können. Nachdem Arendt den Nationalsozialismus und den Stalinismus als politische Regime eines völlig neuen Typs identifiziert hatte, die die totale Vernichtung der Freiheit und die Eliminierung jedes politischen Raumes anstrebten, war sie um die Erhaltung des Begriffs der Freiheit bemüht. Dazu wandte sie sich dem antiken Griechenland zu. Für die Griechen sei es, so Arendt, selbstverständlich gewesen, daß frei sein nicht einfach bedeutete, frei von Beschränkungen zu sein. Diese negative Freiheit sei eine Erfindung des modernen Liberalismus. Freiheit habe für die Griechen bedeutet, daß man in der Lage ist, etwas Neues anzufangen: Daß Freiheit des Handelns gleichbedeutend ist mit dem Einen-Anfang-Setzen-und-Etwas-Beginnen, ist innerhalb des griechischen politischen Bereichs am besten dadurch illustriert, daß das Wort ‚archein’ sowohl anfangen wie herrschen heißt. Arendt schreibt über „die Verkoppelung von Frei-Sein und Beginnen“, und sie begreift Freiheit als etwas, was in direktem Gegensatz zum Versuch der „totalen Herrschaftsformen“ steht, „die Spontaneität des Menschen auf allen Gebieten prinzipiell zu vernichten.“ Diese Einsicht in die Bestrebungen des totalen Staates deutet auch auf seine Grenzen hin. Denn eine solche Herrschaftsordnung, die auf deterministischen Annahmen über die Geschichte der Menschheit beruht, befindet sich in einem permanenten Kampf gegen die pluralistische Natur menschlicher Gesellschaften: Denn gegen die mögliche Festlegung und Erkennbarkeit der Zukunft steht die Tatsache, daß die Welt sich durch Geburt täglich erneuert und durch die Spontaneität der Neu[an]kömmlinge dauernd in ein unübersehbar Neues hineingerissen wird. Arendts Interesse gilt hier zweifellos nicht alleine der biologischen Reproduktion: Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, d.h. zu handeln. Dank dieser Fähigkeit kann politische Macht sogar in äußert repressiven Regimen entstehen und die Geschichte niemals enden. Diese Art von Freiheit und diese Art von Macht, die Arendt im antiken Griechenland aufspürte, traten in der Neuzeit bei Revolutionen oder immer dann zu Tage, wenn Menschen sich zusammentaten, um durch gemeinsames Handeln politische Ziele zu erreichen. Ein zentraler Aspekt von politischer Macht in diesem Sinne ist, daß sie nicht auf Gewalt beruht. Die Ungarische Revolution von 1956 zeigte klar die Grenzen des sowjetischen totalitären Systems sowie jeder anderen Herrschaftsordnung auf, die vor allem mit gewaltsamen Mitteln aufrechterhalten wird. Gleichzeitig hat der Aufstand auch die Grenzen der Vorstellung gezeigt, daß Macht das Gegenteil von Gewalt sei. 20 000 Tote und die Niederlage des Aufstands sprechen für sich. Dies ist der Grund, warum Arendt sich mit revolutionären Räten beschäftigte. In ihnen sah sie eine Art kooperativer Macht, die spontan in politischen Krisenzeiten entsteht und sich die Hierarchie des herrschenden Regimes ersetzen kann, ohne selbst hierarchische Strukturen aufzubauen. Für Arendt war die Bildung von Räten, nicht die Wiedererstehung von Parteien ein klares Zeichen für einen demokratischen Aufbruch gegen die Diktatur, für die Erhebung der Freiheit gegen die Tyrannei. Die Realität der revolutionären Räte – sei es in der Pariser Kommune von 1871, in Rußland im Jahre 1905 und 1917 oder in Ungarn im Jahre 1956 – sah jedoch anders als Arendts idealisierte Vorstellung aus. Besonders ihre Behauptung, die Arbeiterräte seien vor allem an politischer Emanzipation statt an der Verbesserung ihrer materiellen Lage interessiert gewesen, ist problematisch. Aber genauso wie sich Arendts Gedanken über die Rätedemokratie als eine fruchtbringende Quelle von Anregungen für eine normative demokratische Theorie erwiesen haben , können uns ihre Schriften über Revolutionen vielleicht mehr darüber sagen, wie Revolutionen hätten sein sollen als wie sie tatsächlich verlaufen sind. Anscheinend hat Arendt niemals aufgehört, über eine Revolution zu schreiben, die nie stattgefunden hat. Ihr berühmtes Buch Über die Revolution feiert die Amerikanische Revolution von 1776 und bemüht sich, sie vom Schatten ihrer besser bekannten Schwester, der Französischen Revolution von 1789, zu befreien. Wie schon Tocqueville so betont auch Arendt, daß die amerikanischen Revolutionäre wesentlich erfolgreicher den Boden für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit vorbereiteten als die französischen, weil sowohl ihrer Forderungen als auch ihre Methoden weniger radikal waren. Die amerikanischen Revolutionäre verhielten sich außergewöhnlich zurückhaltend, so daß die Revolution gewaltarm blieb. Kein Wunder, daß dem viele Historiker mit dem Argument widersprachen, die Revolution könne nicht vom Bürgerkrieg getrennt werden, es sei viel mehr Blut vergossen worden, als Arendt uns glauben machen will. Ähnlich verhält es sich mit Arendts Bericht über die Ungarische Revolution von 1956. Liest man Arendts Äußerungen heute, könnte man den Eindruck gewinnen, dies sei die erste samtene Revolution in Ostmitteleuropa gewesen: Positiv gesehen war das Erstaunlichste hier, daß aus einer Volksaktion kein Chaos entstand und keine Anarchie. Es kamen keine Plünderungen der Läden vor, überhaupt keine Eigentumsdelikte, und dies in einem Lande, dessen niedriger Lebensstandard und großer Warenhunger notorisch sind. Es gab auch keine Morde, denn in den wenigen Fällen, in denen die Menge zu direkter Aktion schritt und höhere Offiziere der Geheimpolizei öffentlich aufhängte, hat sie sich bemüht, gerecht zu sein und auszuwählen, und nicht einfach jeden aufzuhängen, der ihr in die Hände geriet. Als Arendt über den ungarischen Volksaufstand schrieb, stand sie vor einem Dilemma, mit dem in ähnlicher Weise auch Immanuel Kant – in bezug auf die Französischen Revolution – konfrontiert gewesen war: Wie ist es möglich, die Ziele der Revolutionäre zu billigen oder sie sogar zu teilen, ihre Mittel aber als illegitim abzulehnen? Eine der Möglichkeiten, einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden, besteht darin, die Haltung eines uninteressierten Zuschauers einzunehmen. Kant sah es als erfreulich an, daß sich viele außenstehende Beobachter über das Ereignis freuten, und er betrachtete diese Entwicklung als ein erfreuliches Zeichen moralischen Fortschritts. Dies war etwa die Argumentation im „Streit der Fakultäten“, in dem Kant der Französischen Revolution Beifall zollte, obwohl er ständig darauf hinwies, ziviler Ungehorsam könne nie rechtens sein. „Ein solches Phänomen in der Menschheitsgeschichte vergißt sich nicht mehr“, bemerkte Kant zustimmend. Arendt vollführt einen ähnlichen Drahtseilakt: Wie ist es möglich, Revolutionen als magische Momente der Politik zu feiern, wenn mit ihnen Gewalt einhergeht, was einen Rückfall in den vorpolitischen Bereich bedeutet? Dies könnte leichter fallen, sobald diese Geschehnisse zu Geschichten werden, über die die Menschen sprechen, über die sie ihre Meinung austauschen und an die sie sich öffentlich in angemessener Weise erinnern können. Auf diese Weise können sogar blutige Ereignisse in den Bereich der Politik transferiert werden, in dem Sprechen Handeln ist. Politik als öffentliches Gedächtnis – „Das vergißt sich nicht“ Echtes politisches Handeln sollte nicht nur gepriesen werden, weil es Gesellschaften zum Besseren zu verändern kann. Es ermöglicht vor allem jedem Einzelnen, sein einmaliges Freiheitspotential zu verwirklichen. Um es noch deutlicher auszudrücken, als es Arendt in bezug auf die Führer der Amerikanischen Revolution getan hat: Der moderne Mensch kann nur durch politisches Handeln Unsterblichkeit erlangen. In einem Brief an Arendt, den Karl Jaspers unmittelbar nach den Ereignissen in Ungarn schrieb, evoziert er Kant: „Das vergißt sich nicht.“ Ein Jahr später schrieb Arendt über die Ungarische Revolution als ein „wirkliches Ereignis, das nicht an Sieg oder Niederlage gemessen werden [kann], seine Größe beruht und ist gesichert in der Tragödie, die sich in ihm entfaltete.“ Arendts Einschätzung der Bedeutung, die die Erinnerung an 1956 hat, erwies sich als bemerkenswert weitsichtig. Arendt mag die Fähigkeit des Regimes unterschätzt haben, nach 1956 die öffentliche Erinnerung an die Ereignisse zu unterdrücken. Daß diese erzwungene Stille lebenswichtig für den Erhalt des Regimes war, hat sie aber in aller Klarheit gesehen. Das Ereignis war so wichtig, daß die Geschichte Ungarns seit 1956 als Perzeptionsgeschichte des Aufstands gelesen werden kann. So wie die Unterdrückung der Erinnerung an das Jahr 1956 ein elementarer Bestandteil der kommunistischen Ordnung war, so war auch die feierliche Umbettung des Leichnams von Imre Nagy, der 1958 wegen „konterrevolutionären Verhaltens“ in seiner Zeit als ungarischer Ministerpräsident hingerichtet worden war, im Juni 1989 ein klares Anzeichen für das Ende des Regimes. Als es nach der Implosion des kommunistischen Regimes im Jahre 1989 möglich wurde, offen und frei über die Bedeutung des Jahres 1956 zu diskutieren, artikulierten viele Parteien ihre Programme, indem sie ihr Verhältnis zu diesem Ereignis darlegten. Bevor es soweit kam, zeigte das Regime viele Jahre seine totalitäre Seite, die Arendt vielleicht nicht in aller Klarheit gesehen hat. Es liegt in der Natur eines totalitären Herrschaftssystems, daß es Ideologie zu Realität machen kann. So erklärte z.B. die kommunistische Kádár-Nomenklatura, bei dem Ereignis von 1956 habe es sich nicht um einen Volksaufstand gehandelt, sondern um eine Konterrevolution, also um ein Nicht-Ereignis. Zudem sorgte sie für seine „Nichtexistenz“, indem sie es aus dem öffentlichen Gedächtnis löschte: Das Nicht-darüber-Sprechen war ein wichtiges Mittel, die Geschichte anders darzustellen. In der offiziellen kommunistischen Chronologie verloren bestimmte Daten, Ereignisse und Personen ihre Verständlichkeit. Sobald ein Thema von der offiziellen Geschichtsschreibung bewilligt worden war, verlor es seine Historizität. […] Historische Ereignisse und Akteure sanken dadurch, daß sie tabu waren, in den Bereich der Nichtexistenz hinab, wurden zu Nichtereignissen, Nichtproblemen, Unpersonen. So gesehen diente die physische Vernichtung des wichtigsten Volkshelden von 1956, Imré Nagy, als Rechtfertigung einer speziellen Interpretation jenes Ereignisses. So wie zu stalinistischen Zeiten die Zahl der hingerichteten Opfer der Säuberungen die nicht nachlassende Wachsamkeit der Partei beweisen sollte, so war die Exekution von Imré Nagy im Jahre 1958 das letzte Beweisstück für die ungarische Historiographie, welche behauptete, 1956 habe eine Konterrevolution stattgefunden und Nagy sei ein Verräter gewesen. Dies ist der Schlüssel zum Verständnis des Paradoxons des sogenannten „Gulaschkommunismus“, der in Ungarn nach der teilweisen Liberalisierung des Regimes Anfang der 1960er Jahre entstand. An der Oberfläche schien Kádárs Ungarn in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht recht liberal zu sein, besonders im Vergleich zu anderen Ländern des sowjetischen Imperiums. Gleichwohl basierte das Regime auf Einschüchterung. János Kádár hatte die Autorität eines Mörders. Trotz der Unterdrückung der öffentlichen Erinnerung wußten viele von seiner Verantwortung für den Justizmord an seinem Konkurrenten, aber niemand durfte ihn je erwähnen Es ist bezeichnend, daß das erste frei gewählte Parlament bemüht war, die öffentliche Erinnerung in ein Gesetz zu gießen. Bereits in seiner ersten Sitzung im Mai 1990 verkündete es: Der 23. Oktober, der Tag des Ausbruchs der Revolution von 1956 und des Beginns des Freiheitskampfes und auch der Tag der Verkündung der ungarischen Republik im Jahre 1989, soll von jetzt an ein Nationalfeiertag sein. Ein anderer Versuch, die öffentliche Erinnerung zu kodifizieren, war die Eröffnung des umstrittenen Museums „Haus des Terrors“ im Jahre 2002, das die Ereignisse des Jahres 1956 sehr einseitig präsentiert. Ob irgendein legislativer Akt oder ein Museum in einem demokratischen Gemeinwesen „die historische Bedeutung“ eines Ereignisses „kodifizieren“ kann, sei dahingestellt. Besonders problematisch ist, daß der Zusammenhang zwischen dem Jahr 1956 und dem Jahr 1989 in Ungarn oft allzu eng gesehen wird. Vernachlässigt wird dabei, welche Rolle der Wandel der internationalen Lage beim Niedergang des Kommunismus im Jahre 1989 spielte, insbesondere die Rolle der Sowjetunion. Grenzen des sowjetischen Imperialismus Arendt hat gesehen, daß das sowjetische Imperium von seinen Rändern, d.h. durch die erst nach dem Zweiten Weltkrieg einverleibten Länder Ostmitteleuropas herausgefordert werden würde. Ebenso war ihr klar gewesen, daß die Aufrechterhaltung des Imperiums eng mit der Aufrechterhaltung des kommunistischen Regimes im Mutterland verbunden war. Sobald das Regime offenbarte, das es das Imperium aufgeben könnte, untergrub dies seine Position im Mutterland. Dies mußte Michail Gorbačev einige Jahrzehnte später erfahren. Es sei daran erinnert, daß ein zentraler Aspekt der Perestrojka das Neue Denken in der sowjetischen Außenpolitik war, wozu der Verzicht auf die Brežnev-Doktrin von der begrenzten Souveränität der Staaten des Warschauer Pakts gehörte. Arendt hatte auch in vieler Hinsicht recht, was das Verhältnis zwischen Macht und Gewalt in den Revolutionen in Ostmittel- und Osteuropa betraf, welche dem Scheitern von 1956 folgten. Mit guten Gründen kann man behaupten, daß der Erfolg zum großen Teil davon abhing, wie weit sie dem „Arendtschen Modell“ der Revolutionen nahekamen. Sowohl die Revolutionäre wider Willen als auch die Großmächte mußten nach und nach ihre eigenen Lektionen über die Dynamik politischer Macht und die Grenzen eines Regimes lernen, das ausschließlich auf der Androhung von Gewalt beruhte. Die gewaltlosen Revolutionen von 1989 wurden dadurch ermöglicht, daß sogar die Machthaber in Moskau diese Arendtsche Lehre akzeptierten. Einer der erstaunlichsten neuesten Funde in den Archiven ist, daß sogar Chruščev und Kádár sich zumindest bis zu einem gewissen Grade bereits 1956 dieser Grenzen bewußt waren. Kádár warnte seine sowjetischen Partner ausdrücklich vor der Invasion. Nicht nur, weil diese „destruktiv wäre und zu Blutvergießen führen könnte“, sondern auch wegen der sich daraus ergebenden politischen Konsequenzen. Kádár sagte voraus, die „Moral der Kommunisten [werde] auf null reduziert“ und „die Autorität der sozialistischen Ländern untergraben.“ Obwohl Kádár seine Prophezeiung bis zu einem gewissen Grade „widerlegte“, indem er die Entwicklung in Ungarn gut drei Jahrzehnte lang aufhielt, können diese Dekaden in der Rückschau als permanente Legitimitätskrise der kommunistischen Herrschaft in Ostmittel- und Osteuropa charakterisiert werden. Die Meilensteine dieser lange währenden Legitimationskrise sind bekannt: den Ereignissen von 1956 in Ungarn und Polen folgten der Prager Frühling von 1968 und die Gründung der Charta 77 in der Tschechoslowakei, denen wiederum die Solidarność-Bewegung in Polen folgte. Die Tatsache, daß der Prager Frühling von 1968 in der Tschechoslowakei stärker dem Arendtschen Modell der gewaltlosen Macht in Aktion entsprach, bedeutete, daß er sogar eine noch ernstere Herausforderung der sowjetischen Herrschaft war als der Aufstand in Ungarn 1956. Was die Durchführung der militärischen Operation betrifft, so war der sowjetisch angeführte Einmarsch in der Tschechoslowakei viel leichter und kostete weniger Menschenleben als die Unterdrückung des Ungarischen Aufstands. Die Restauration der Legitimität des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei war jedoch wesentlich schwieriger. Die Tschechoslowakei lieferte 1968/69 ein beeindruckendes Beispiel „zivilen Kampfes zur nationalen Verteidigung“. Obwohl die Tschechen und Slowaken besiegt wurden, hinderten sie „acht Monate lang die Russen daran, ihr politisches Ziel zu erreichen – ein Regime, das den sowjetischen Wünschen nachkam.“ Außerdem hatte die Unterdrückung des Prager Frühlings sogar noch mehr als die Invasion in Ungarn im Jahre 1956 unbeabsichtigt zur Folge, daß die kommunistische Ideologie im Westen delegitimiert wurde. Arendt betrachtete die sowjetisch angeführte Intervention in der Tschechoslowakei als ein Zeichen der Schwäche, welche den weiteren Niedergang des sowjetischen Imperiums kennzeichnete: Nackte Gewalt tritt auf, wo Macht verloren ist. Die russische Lösung des tschechischen Problems zeigte deutlich einen entscheidenden Machtverlust des russischen Regimes an… Man kann Macht durch Gewalt ersetzen, und dies kann zum Siege führen, aber der Preis solcher Siege ist sehr hoch; denn hier zahlen nicht nur die Besiegten, der Sieger zahlt mit dem Verlust der eigenen Macht. Tatsächlich bezeichnete kein Geringerer als Michail Gorbačev den Prager Frühling als das Ereignis, das ihm die Grenzen der Gewalt als einer Quelle politischer Macht verdeutlichte. Diese Einsicht hilft zu verstehen, warum die „Colts nicht rauchten“ als sich der Zerfall des sowjetischen Imperiums abzeichnete. Die Sowjetunion hätte sehr wohl die militärische Kapazität gehabt, dies zu verhindern. Doch die politische Führung hatte den Glauben ihrer Vorgänger verloren, daß Macht mit Gewalt aufrechterhalten werden kann. Es sei jedoch daran erinnert, daß sich der Erfolg der gewaltlosen Revolution in Ostmitteleuropa zum großen Teil nicht auf Gorbačevs Klugheit gründete, sondern vielmehr auf seine Bereitschaft, die Konsequenzen seiner Fehleinschätzung zu tragen. Tatsächlich mag man einwenden, der friedliche Kollaps des Kommunismus sei durch eine Reihe fataler Fehlurteile der kommunistischen Eliten ermöglicht worden. Ebenso wie der Marxismus gerade durch die Vorhersage des bevorstehenden Zusammenbruchs seinen Teil zur Stabilisierung der liberalen Demokratie und des kapitalistischen Wirtschaftssystems beigetragen hat, war der Glaube an die Unbesiegbarkeit des kommunistischen Systems ein wichtiger Faktor bei seinem endgültigen Untergang im Jahre 1989: Hätte das Politbüro der sowjetischen Kommunistischen Partei die Konsequenzen der Wahl Gorbačevs zum Generalsekretärs der Partei vorhergesehen, so wäre er wahrscheinlich nicht gewählt worden (statt dessen wäre er vielleicht sofort erschossen worden), und dies wiederum hätte der Geschichte der Sowjetunion vielleicht eine ganz andere Wendung gegeben. Die Tatsache, daß kaum jemand den Kollaps des Kommunismus vorhersehen konnte, erklärt vielleicht seinen gewaltlosen Charakter. Sowohl die kommunistischen Eliten als auch die oppositionellen Bewegungen waren entschlossen, eine weitere Konfrontation wie die im Jahre 1956 in Ungarn zu vermeiden, aber ihre Ziele waren völlig unterschiedlich. Gorbačev und die reformistischen kommunistischen Kader in Polen und Ungarn glaubten, durch den Verzicht auf Gewalt würden sie ihre politische Position stärken und die Zukunft des Sozialismus sichern. Für die oppositionellen Bewegungen hingegen bestand das Ziel darin, immer mehr Raum für eine glaubwürdige Politik zu schaffen, die seit dem Scheitern des Prager Frühlings mit immer weniger Bezügen auf den Marxismus artikuliert wurde. Obwohl die kommunistischen Eliten vielleicht die negative „Arendtsche“ Lektion über die Grenzen der auf Gewalt beruhenden Macht gelernt hatten, unterschätzten sie die Herausforderungen, politische Macht durch „vereintes Handeln“ zu erlangen, und ließen ungewollt den Erfolg der oppositionellen Bewegungen zu. Die Zukunft von 1956 Fünfzig Jahre nach dem ungarischen Aufstand bleiben seine Bedeutung und Beziehung zu den neueren postkommunistischen Entwicklungen in Ungarn und Europa größtenteils umstritten. Das ist nicht verwunderlich: „Die Vergangenheit ist niemals tot, sie ist nicht einmal vergangen.“ Man kann im Nachhinein leicht sagen, daß sich Menschen wie János Kádár täuschten, als sie dachten, sie könnten die Zukunft dadurch determinieren, daß sie die Vergangenheit unter Kontrolle hielten. Als die Reformkommunisten versuchten, sich als Sozialdemokraten neu zu erfinden, entpuppte sich der Versuch, die öffentliche Erinnerung an 1956 zu unterdrücken, als kontraproduktiv. Nagy galt nun trotz – oder gerade wegen – der jahrzehntelangen Dämonisierung als perfekter Demokrat. Vielleicht ist er durch seinen Tod populärer geworden, als er es hätte werden können, wenn er am Leben geblieben wäre, denn der Tote konnte Menschen mit radikal anderen politischen Überzeugungen nicht daran hindern, ihn als ihren Helden zu beanspruchen. Nach 1989 konnten Antikommunisten, Liberale und sogar Konservative behaupten, die Ziele von 1956, die Ziele von Imré Nagy, seien ihre Ziele gewesen. Aber 1989 war nicht einfach eine Wiederholung von 1956 und hätte es auch gar nicht sein können. Sogar Arendt wäre wohl über die postkommunistischen Entwicklungen in Ungarn und im gesamten Ostmitteleuropa enttäuscht gewesen. Obwohl die Revolutionen von 1989 Arendt und ihren Glauben an die Möglichkeit eines Neuanfangs rechtfertigten, führten sie ungeachtet der antipolitischen Rhetorik und der anfänglichen Begeisterung für das Konzept der Zivilgesellschaft nicht zu einer neuen Form von Rätedemokratie. Bedeutet dies, daß das Erbe von 1956 aus dem Gedächtnis verschwinden wird? Am Vorabend des fünfzigsten Jahrestages der Revolution gibt es keine Anzeichen dafür, daß dies geschieht. Was sehr wohl geschehen könnte ist, daß die öffentlichen Feiern zum Gedenken an die Ereignisse das Jahres 1956 dem Erbe mehr Schaden zufügen werden als die vierzig Jahre erzwungen Schweigens. Um eine engstirnige Instrumentalisierung von 1956, wie sie im „Haus des Terrors“ versucht wird, zu verhindern, sollte man sich an den offenen Charakter aller wirklich politischen Projekte erinnern. „Der verlorene Schatz der Revolution“ , um Arendts unvergeßliche Formulierung zu gebrauchen, wird vielleicht niemals gefunden werden, aber dies sollte uns nicht daran hindern, es zu versuchen.
Volltext als Datei (PDF, 240 kB)