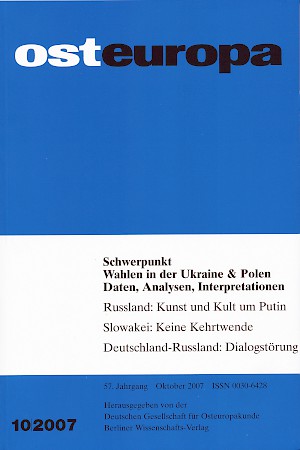Erzwungener Pluralismus
Kommunizierende Röhren in der Ukraine
Volltext als Datei (PDF, 188 kB)
Abstract in English
Abstract
In der Ukraine existiert ein labiler Pluralismus. Seit 1992 konnten die konkurrierenden Eliten weder ein autoritäres System verankern noch die Demokratie konsolidieren. Verantwortlich dafür sind dysfunktionale Institutionen, eine schwache Gesellschaft und die Fragmentierung der Eliten. Der letzte Versuch, nach der Orangenen Revolution die Demokratie zu konsolidieren, scheiterte, weil die Eliten es verpassten, neue Machtstrukturen und demokratische Verfahren zu schaffen. Doch das Verdienst der „Orangenen Revolutionäre“ bleibt, wie bei kommunizierenden Röhren die Verbindung zwischen Gesellschaft und Eliten wieder hergestellt zu haben. Der Ausgang der vorgezogenen Wahlen eröffnet die Chance, einen neuen Anlauf zu institutionellen Reformen und zur Rechtsstaatlichkeit zu nehmen.
(Osteuropa 10/2007, S. 15–28)
Volltext
Vor einigen Jahren analysierte der amerikanische Politikwissenschaftler Lucan Way die politischen Besonderheiten einiger postsowjetischer Staaten und kam zu dem optimistischen Schluss, dass zumindest in zwei von ihnen – in der Ukraine und Moldova – die Konsolidierung autoritärer Regimes nach dem Muster von Belarus oder Russland aus internationalen und innenpolitischen Gründen wenig wahrscheinlich sei. Gleichzeitig sprach er die weitaus weniger optimistische Warnung aus, dass dieselben inneren Faktoren, die einer autoritären Konsolidierung entgegenstehen, auch eine Konsolidierung der Demokratie behinderten. Es ging ihm vorrangig um die Dysfunktionalität und Schwäche der Institutionen in den postkommunistischen Staaten sowie um die starke Fragmentierung der ukrainischen (und moldavischen) Eliten. Das relativ große Maß an Offenheit und Konkurrenz in diesen Gesellschaften, so Way, sei weniger einer entwickelten Zivilgesellschaft, starken demokratischen Institutionen und einer demokratiefähigen Führung geschuldet als vielmehr der Unfähigkeit dieser Führung, die politische Macht in ihren Händen zu konzentrieren, die notwendige Einheit unter den Eliten herzustellen, die erforderliche Kontrolle über die Wahlen und die Massenmedien zu etablieren und gegen ihre Gegner gegebenenfalls gewaltsam vorzugehen. Da es den lokalen postkommunistischen Eliten in der ersten Zeit an den erforderlichen Fertigkeiten, an Legitimation, finanziellen und administrativen Ressourcen fehlte, um eine autoritäre Macht durchzusetzen, etablierte sich nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Auflösung der Kommunistischen Partei praktisch in allen postsowjetischen Staaten genau diese Spielart von „Demokratie“. Lucan Way nennt dieses System ironisch „erzwungenen Pluralismus“. Seinen wesentlichen Merkmalen nach ist dieses System einem schwachen, kraftlosen, nicht konsolidierten Autoritarismus bedeutend näher als einer (scheinbar) jungen und unreifen Demokratie. Entscheidend ist hier weniger das Fehlen demokratischer Strukturen (Institutionen, Gesetze, Gesetzesdurchsetzung in der Praxis), als vielmehr die mangelnde Bereitschaft der postkommunistischen Nomenklatura-Eliten, diese Strukturen zu bilden, sowie die Unfähigkeit der Gesellschaft, ihre Eliten zu verändern und sie zu demokratischen Reformen zu zwingen. Bereits vor Lucan Way zogen etliche Autoren das Transformationsparadigma in Zweifel, insbesondere die Grundthese, wonach alle Länder, die die Diktatur abgeschüttelt haben, sich in Richtung Demokratie bewegen: Die am stärksten verbreiteten Modelle der politischen Entwicklung von Transformationsländern sollte man als alternative Richtungen begreifen und nicht als Übergangsstationen auf dem Weg zur liberalen Demokratie. […] Eine instabile Mittelstellung zwischen echter Demokratie und offener Diktatur ist heute die typische Position der meisten postkommunistischen Länder und Entwicklungsländer. […] Die meisten „Transformationsländer“ sind weder Diktaturen noch „junge Demokratien“. Sie befinden sich in einer politischen Grauzone. Sie verfügen über Attribute eines demokratischen Systems, zu denen ein gewisser, wenn auch beschränkter, politischer Raum für oppositionelle Parteien und eine unabhängige Zivilgesellschaft sowie regelmäßige Wahlen und demokratische Verfassungen gehören. Sie leiden allerdings an einem eklatanten Demokratiedefizit, insbesondere betrifft das die absolut mangelhafte Interessenvertretung der Bürger, die schwache Partizipation an politischen Prozessen (außer der Wahlbeteiligung), häufige Gesetzesverletzungen durch Staatsangestellte, Wahlen mit zweifelhafter Legitimierung, geringes Vertrauen in die staatlichen Institutionen und ihre traditionell fehlende Effizienz. Thomas Carothers verweist auf die Vielfalt der Modelle inmitten der Grauzone. Sie alle führen zu einem von zwei politischen Syndromen, die keine fest umrissenen politischen Systeme, sondern eher bestimmte Modelle darstellen, die ziemlich verbreitet und relativ stabil sind. Das erste Syndrom nennt er „labilen Pluralismus“, das zweite „Politik der dominanten Macht“. Länder, deren politisches Leben sich durch labilen Pluralismus auszeichnet, haben in der Regel eine signifikante Menge an politischen Freiheiten, regelmäßige Wahlen und Machtwechsel zwischen genuin unterschiedlichen politischen Gruppierungen. Trotz dieser positiven Züge ist die Demokratie weiterhin äußerst oberflächlich und gefährdet. Die politische Partizipation geht trotz hoher Wahlbeteiligung nicht über das Wählen hinaus. Die politischen Eliten aller größeren Parteien und Gruppierungen werden generell als korrupt, eigennützig und ineffizient wahrgenommen. Machtwechsel erscheinen lediglich als endloses Hin- und Herreichen der ungelösten Probleme eines Landes von einer glücklosen Regierung zur nächsten. Die Öffentlichkeit ist von der Politik tief enttäuscht, und obwohl sie prinzipiell den Idealen der Demokratie weiterhin aufgeschlossen gegenüber steht, ist sie in der Praxis extrem unzufrieden mit dem politischen Leben ihres Landes. Insgesamt wird Politik als ein verrotteter, korrupter, elitedominierter Raum wahrgenommen, von dem das Land wenig Gutes zu erwarten hat und der daher wenig Respekt verdient. Der Staat bleibt dauerhaft schwach. Der Wirtschaftspolitik fehlt es häufig an Konzepten, und die Wirtschaftsdaten sind dauerhaft schlecht oder sogar katastrophal. Die sozialen und politischen Reformen sind genauso schwach, und eine Regierung nach der anderen ist unfähig, Fortschritte bei der Lösung der Hauptprobleme des Landes, von der Kriminalität und Korruption bis zum Gesundheitswesen und der Bildung zu erzielen und den allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstand zu heben. Am weitesten verbreitet ist der labile Pluralismus Carothers zufolge in Lateinamerika, einer Region, in der die meisten Länder ihre demokratischen Transformationen mit einem bereits vorhandenen breiten Spektrum an politischen Parteien, aber auch einer langen Tradition schlecht funktionierender staatlicher Institutionen begannen. In der postkommunistischen Welt seien Anzeichen dieses Syndroms in Albanien, Bosnien, der Ukraine, Moldova und zum Teil in Rumänien und Bulgarien zu beobachten. In Ländern mit einer schwachen Demokratie, erläutert Carothers, sind die Parteien, die um die Macht kämpfen, so stark von blindem Hass aufeinander erfüllt, dass sie ihre gesamten oppositionellen Anstrengungen ausschließlich darauf richten, dem Gegner die Erreichung jedweden Ziels unmöglich zu machen; die politischen Kämpfe werden zwischen stark verfeindeten Parteien ausgetragen, die wie Netzwerke von Klientelgruppen handeln, ohne jeglichen Versuch einer Selbsterneuerung; die Macht geht von einer kurzlebigen politischen Gruppierung auf die nächste über, an deren Spitze jeweils ein charismatischer Führer steht, oder auf temporäre Allianzen mit einer vagen politischen Identität wie in Guatemala oder in der Ukraine. Und unabhängig von allen Unterschieden haben die Länder mit einem labilen Pluralismus eines gemeinsam: Die ganze politische Klasse, wenngleich pluralistisch und miteinander konkurrierend, ist vollkommen losgelöst von ihren Bürgern. Ihr gesamtes politisches Leben ist eine völlig leere, inhaltslose Beschäftigung. Das zweite politische Syndrom in der Grauzone zwischen konsolidierter Demokratie und konsolidierter Diktatur ist die Politik der dominanten Macht: Länder mit diesem Syndrom haben einen begrenzten, aber immer noch realen politischen Raum, ein gewisses politisches Aufbegehren von Seiten oppositioneller Gruppen und schließlich auch etliche grundlegende institutionelle Formen von Demokratie. Allerdings dominiert eine einzige politische Gruppe – eine Bewegung, eine Partei, eine verzweigte Familie oder ein einzelner Führer – dieses System derart, dass es für einen Machtwechsel in absehbarer Zukunft praktisch keine Chance gibt. […] Ähnlich wie in schwachen, pluralistischen Systemen sind die Bürger in machtdominierten Systemen von der Politik enttäuscht und von signifikanter politischer Partizipation mit der Ausnahme von Wahlen ausgeschlossen. Da es aber keine Machtwechsel gibt, ist die Position „Ach, hol euch alle der Teufel“ hier eher untypisch, während sie für die Systeme des labilen Pluralismus äußerst charakteristisch ist. Auch hier ist der Staat schwach und ineffizient, aber das Problem besteht eher in der Bürokratie, die infolge der Stagnation auf Grund der de facto bestehenden Ein-Partei-Herrschaft weiter zunimmt, als im chaotischen, instabilen Zustand des staatlichen Managements (der ständige Austausch von Ministern zum Beispiel), wie er für den labilen Pluralismus typisch ist. Carothers behauptet, dass politische Systeme, die sich durch das Syndrom des labilen Pluralismus oder das Syndrom der dominanten Macht auszeichnen, trotz ihres vermeintlichen Transformationscharakters recht stabil sein können, allerdings sind sie weniger stabil als eine konsolidierte Demokratie oder ein konsolidierter Autoritarismus. Das System des labilen Pluralismus kann in der Tat ein prekäres Gleichgewicht erreichen: das Hin- und Herreichen der Macht zwischen konkurrierenden Eliten, die völlig losgelöst von den Bürgern agieren, sich dabei aber an allgemein akzeptierte Regeln halten. Das System der dominanten Macht kann noch stabiler sein mit einer herrschenden Gruppe, die die Opposition unter Kontrolle zu halten vermag und gleichzeitig genügend politische Freiheit gewährt, um den gesellschaftlichen Druck gering zu halten. Kein System besteht allerdings dauerhaft. Die Länder können von einem ins andere System wechseln oder sich von beiden entfernen und sich in Richtung liberale Demokratie oder Diktatur bewegen. Die Entwicklung der Ukraine ist eine passende Illustration für eine solche Bewegung, genauer für ein Schwanken zwischen labilem Pluralismus und einer Politik der dominanten Macht – mit einer kontinuierlichen Annäherung an den konsolidierten Autoritarismus in den letzten Jahren unter Leonid Kučma und dem deutlichen, aber erfolglosen Versuch, die Demokratie zu konsolidieren, in den ersten Jahren unter Viktor Juščenko. Vom dysfunktionalen Staat zum Erpresserstaat Die offensichtliche Ähnlichkeit zwischen der „labilen“ Demokratie unter Leonid Kravčuk (1991–1994) und Viktor Juščenko (2005–2006) verlangt nach einer Klärung der Gründe für diese Ähnlichkeit, die struktureller Art sind und weniger mit den Persönlichkeiten der Präsidenten oder den Besonderheiten ihres jeweiligen Umfeldes – im ersten Fall die kommunistische Nomenklatura, im zweiten der Kreis der aus dem Komsomol hervorgegangenen Geschäftsleute – zu tun haben. Die Impotenz der Macht, die alle politischen Beobachter bereits in den ersten Monaten unter Juščenko feststellten, als die am tiefsten in Korruptionsaffären verwickelten Leute des Kučma-Regimes ungestraft nach Russland emigrieren konnten, und die selbst die stärksten Juščenko-Sympathisanten nicht mehr leugnen konnten, als diese „Politemigranten“ später triumphierend in die Ukraine zurückkehrten, diese Impotenz der Macht hat ihre Ursachen in denselben Mängeln des „labilen Pluralismus“, der unzureichend institutionalisierten (Quasi-)Demokratie wie die Impotenz der Macht unter Kravčuk gegenüber der dreisten Krim- und Schwarzmeer-Politik des Kreml zu Beginn der 1990er Jahre oder gegenüber dem Druck der Roten Direktoren aus dem Donbass, die in den Jahren 1993/1994 eiskalt die Bergarbeiter für ihren Kampf gegen Kyïv benutzten. Das, was Julija Mostova im März 2006 über die Ukraine der Gegenwart schrieb, lässt sich ebenso auf die Kravčuk-Zeit im Jahre 1993 beziehen: Genau genommen gibt es sie, die Macht, gegenwärtig gar nicht. Hundertfach werden Anweisungen und Erlasse des Präsidenten, richterliche Urteile oder Beschlüsse der Verchovna Rada nicht umgesetzt; vor der Staatsanwaltschaft oder vor einem Gericht in einer öffentlichen Angelegenheit ein gerechtes und „nicht stimuliertes“ Urteil zu erstreiten, ist praktisch unmöglich; die Umsetzung eines gefällten Urteils vor Ort zu bewerkstelligen, ist äußerst schwierig. Und die Hauptsache ist, dass sich niemand damit befasst. Kein Wille, keine Disziplin, kein klares Ziel. In beiden Fällen werden die Ursachen für die Impotenz der staatlichen Macht verständlicher, wenn wir uns vor Augen führen, dass die unabhängige Ukraine von der Sowjetunion ausschließlich Institutionen geerbt hat, die nicht dafür vorgesehen waren, eigenständig unter demokratischen (und nicht totalitären) Bedingungen zu funktionieren, und das deshalb auch nicht vermochten. Alle Institutionen – das Parlament und die Regierung, die Stadtparlamente und Lokalverwaltungen, die Gerichte und der Zoll, die Verbände der Künstler und Schriftsteller sowie die Akademie der Wissenschaften – standen in einem Abhängigkeitsverhältnis, sie fungierten als Instrumente des realen Machtzentrums, das das Funktionieren des Gesamtsystems sicherstellte. Die Kommunistische Partei war der Hauptmotor, die treibende Kraft. Sie war es, die alle mehr oder weniger wichtigen Entscheidungen traf, alle mehr oder weniger wesentlichen Veränderungen initiierte, sie wachte über die Loyalität ihrer Untertanen, strafte und belohnte. Die Beschneidung des Einflusses der Kommunistischen Partei während der Perestrojka wirkte sich folgerichtig auf die Effizienz des gesamten staatlichen Mechanismus aus. Ihre Vertreibung von der politischen Bühne nach dem gescheiterten August-Putsch 1991 in Moskau, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Rolle der Partei und die Lenkung des gesamten Staates neu zu definieren, führte zum unvermeidlichen Zusammenbruch der Sowjetunion. Die regionalen Eliten in den postsowjetischen Staaten, denen die dysfunktionalen Reste des dysfunktionalen Imperiums zugefallen waren, standen vor einer schwierigen Wahl: Entweder mussten sie neue Institutionen schaffen, die sich auf Rechtsstaatlichkeit, demokratische Verfahren und die Aktivität des Bürgers stützen, oder mit Hilfe irgendwelcher neuen, informellen Methoden und halblegalen Organe die dysfunktionalen Quasi-Institutionen des leninschen Staates wiederbeleben. Nur die baltischen Republiken wählten ohne zu zögern den ersten Weg. Alle anderen, einschließlich der Ukraine, entschieden sich für den altbekannten, zweiten Weg. Die Präsidialverwaltungen lösten die Zentralkomitees der Kommunistischen Partei ab (an den jeweiligen Gebäuden wurden die Schilder ausgetauscht), und die Präsidentenvertreter („Gouverneure“) mit ihrem Machtapparat ersetzten die lokalen Parteibosse in den Regionen. Das entscheidende Element, das diesen neu geschaffenen (oder eigentlich rekonstruierten) Mechanismus zur effektiven Arbeit hätte veranlassen können, fehlte allerdings. Leonid Kravčuk versäumte es, dieses Element einzuführen, und verlor 1994 seine Macht. Kučma erwies sich als erfolgreicher, denn er schuf ein (für seine Zwecke) exzellentes Monster, das die Politologen später als „Erpresserstaat“ bezeichneten. 1999 schaffte es das Monster, dem absolut unpopulären Präsidenten zum zweiten Wahlsieg zu verhelfen, und es wäre vielleicht auch 2004 erfolgreich gewesen, hätte es nicht die unseligen Tonbandaufzeichnungen des Majors der Präsidentengarde und Ex-Geheimdienstlers Mykola Melnyčenko gegeben und wäre das Kučma-Regime nicht – national wie international – vollkommen delegitimiert gewesen. Um die Genialität von Kučma zu begreifen, die eher eine intuitive als intellektuelle, eher eine kriminelle als staatsbildende war, darf man nicht vergessen, dass die Schattenmacht der Kommunistischen Partei auf der kommunistischen Ideologie gründete, die für jeden zwingend war, der eine mehr oder weniger wichtige gesellschaftliche Position einnahm oder zumindest anstrebte. Der Marxismus-Leninismus war ein wirksames Mittel staatlicher Dominanz, denn durch „ideologische Erpressung“ war jeder Untertan zur Loyalität zu zwingen. In diesem totalitären System kam eine ideologische Entfernung von der Partei (oder vom Komsomol) einer Entfernung von Staat, Arbeit, Bildung und Karriere gleich, sie bedeutete einen Ausschluss von allem, was man mit der Vorstellung von einem „normalen“ Leben verbindet. In den postsowjetischen Ländern, die sich formal vom Eigentumsmonopol und der für alle verbindlichen Ideologie verabschiedet hatten, verringerten sich die Möglichkeiten der außergesetzlichen, informellen Einflussnahme auf die Untertanen beträchtlich. Das Kravčuk-Regime versuchte die Bürger durch Bestechung und Kooptierung unter Kontrolle zu halten, Kučma und sein Kreis hingegen fanden mit der ökonomischen Erpressung einen wirkungsvollen Ersatz für die ideologische Erpressung. Die Schlüsselrolle kam in diesem System nicht mehr den Parteikomitees oder dem KGB, sondern den Steuerbehörden zu. Wie alles Geniale ist der „Erpresserstaat“ ziemlich einfach konstruiert. Einerseits toleriert er die Korruption und begünstigt sie sogar (je mehr Staatsangehörige unmoralisch handeln, umso besser). Andererseits verfolgt er genauestens alle Bestechungsaktionen, sammelt über jeden Einzelnen kompromittierendes Material und setzt es im entsprechenden Moment gegen illoyale (oder nicht ausreichend loyale) Untertanen ein. So ist jedes politisch oder ökonomisch aktive Subjekt erpressbar, und jegliche Rache an einem solchen Subjekt wird zu einer formal absolut gerechtfertigten Bestrafung für Korruptionsverbrechen. Um diesen Mechanismus in Gang zu setzen, musste natürlich zuvor eine umfangreiche Privatisierung des Staatseigentums erfolgen (und das nach Möglichkeit mit einer extrem hohen Anzahl von Gesetzesverletzungen, damit man erforderlichenfalls jeden daran erinnern konnte). In gewisser Hinsicht könnte man sagen, dass Leonid Kravčuk, der sich nicht zu einer umfassenden Privatisierung entschließen konnte, sich damit selbst der Mechanismen für eine nachhaltige Einflussnahme auf seine politischen Gegner und für eine Stimulierung des eigenen Lagers beraubte. Leonid Kučma nutzte indessen die neu geschaffenen Mechanismen erfolgreich, um sich die regionalen Oligarchen gefügig zu machen, den Separatismus auf der Krim zu entschärfen und später auch, um die politische Opposition zur „konstruktiven“ Zusammenarbeit zu zwingen. Es war ein Glück für die Ukraine (und ein Unglück für Kučma), dass die Aufnahmen von Melnyčenko eine recht gute Vorstellung von den beschriebenen Mechanismen vermitteln. In der Tat überwand Leonid Kučma das Durcheinander des dysfunktionalen Staates unter Kravčuk, indem er die ineffizienten, korrupten Strukturen zum Arbeiten brachte. Das korrupte, ineffiziente Wesen der Institutionen änderte er allerdings nicht, und so stand die „orangene Macht“, die von Kučma einen weiterhin sowjetischen, seinem Wesen nach immer noch leninschen Staat übernommen hatte, wieder vor demselben Dilemma wie Leonid Kravčuk zu Beginn der 1990er Jahre: wie die Polen, Balten oder Tschechen neue Institutionen zu schaffen oder die alten anzupassen. Neue Institutionen wurden nicht geschaffen. Die alten Institutionen haben es geschafft, die neue (Möchte-gern-)Macht an sich anzupassen. Die Revolution als Rückkehr zur Evolution Die Orangene Revolution scheiterte nicht am 7. Juni 2006, als die Sozialistische Partei mit Oleksandr Moroz an der Spitze die „Orangene Koalition“ verließ, sich der Partei der Regionen unter Viktor Janukovyč anschloss und ihr somit zusammen mit den Kommunisten die erforderliche parlamentarische Mehrheit zur Bildung einer „antiorangenen“ Regierung verschaffte. Die Orangene Revolution scheiterte bereits im Februar 2005, als der Präsident – in eigener Person und in Gestalt seines Justizministers – verkündete, die ukrainische Gesellschaft brauche kein Überprüfung früherer Funktionäre. In der Praxis bedeutete das nicht nur, dass die Fälscher der vorangegangenen Wahlen, die korruptesten Figuren und größten Unterdrücker demokratischer Freiheiten unter dem Kučma-Regime ungestraft davonkamen. Es bedeutete auch das Nein zu institutionellen Reformen – der alte sowjetische KGB, neu ummäntelt als Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU), die extrem korrupten Zoll- und Steuerbehörden, die brežnevsche Miliz und die stalinsche Staatsanwaltschaft, die Systeme der Nomenklaturaprivilegien für hohe Staatsbeamte und natürlich auch die zweifelhaften Öl- und Gasverquickungen, an deren Ausbau das frühere „volksfeindliche Regime“ fleißig gearbeitet hatte. Sie alle blieben unangetastet. Bei aller Ähnlichkeit des „labilen Pluralismus“ vom Anfang der 1990er Jahre und von heute war er unter Kravčuk zugegebenermaßen wirklich erzwungen, der Präsident hatte damals einfach keine Mittel, um diesen „Pluralismus“ zu bezwingen. Juščenko hingegen hat sich bewusst, wenn vielleicht auch schweren Herzens dafür entschieden: Man kann ihm vieles vorwerfen, keinesfalls allerdings den Versuch, Kučmas Methoden des Erpresserstaats einzusetzen. Obwohl das kompromittierende Material zweifelsohne für steuerliche und jegliche andere Erpressungen seiner Gegner für weit mehr als eine weitere Amtszeit gereicht hätte. Und in dieser Hinsicht ist er eine viel tragischere Gestalt als Kravčuk: Obwohl er bewusst darauf verzichtet hat, Mechanismen der autoritären Macht einzusetzen, ist es ihm nicht gelungen, Mechanismen der demokratischen Macht zu implementieren. Seinerzeit haben viele – darunter auch ich – die Orangene Revolution mit den friedlichen Revolutionen in Osteuropa zwischen 1989 und 1991 verglichen, die in Belgrad, Tbilissi und Kyïv mit über zehnjähriger Verspätung ankamen. James Sherr stellte vor kurzem eine treffende Parallele zu den europäischen Revolutionen von 1848 her, die in ähnlicher Weise die alte Ordnung zu Fall gebracht hatten, es aber auch nicht vermochten, die Machtstrukturen zu ändern: In der Orangenen Revolution und auch in den europäischen Revolutionen des Jahres 1848 wurde die alte Ordnung zerstört, während Machtquellen und -strukturen intakt blieben. Damals wie heute machten die „revolutionären“ Führer in den alten Strukturen Karriere. Deren parasitären, eigennützigen, wohlfahrtsvernichtenden und insbesondere boshaften Charakter haben sie nie wirklich verstanden. In einigen Bereichen haben sie die Politik verändert, aber sie haben praktisch nichts unternommen, um die zivilgesellschaftlichen Institutionen zu verändern, die ihnen zur Macht verholfen hatten. Sie hatten einen demokratischen, europäischen Geist, aber es fehlte ihnen an Nachdrücklichkeit und jeglichem Gespür für Gefahr. Sherr zufolge haben die Ukrainer das Wichtigste versäumt, was alle osteuropäischen Revolutionen 1989 auszeichnete: Nach der Revolution die Spielregeln zu ändern, damit der Opponent, wenn er wieder an die Macht kommt, neue Regeln, einen neuen Diskurs und eine neue Realität akzeptieren muss. Er muss mit anderen Worten transformiert zurückkommen. Die „Revolutionäre in Orange“ schufen nicht die Bedingungen, unter denen ein Opponent, der an die Macht zurückkehren will, sich vollkommen verändern muss. Deshalb ist das Risiko einer Konterrevolution heute sehr hoch, weil die revolutionären Veränderungen unter Juščenko nur minimal waren. Die Ukraine ist offenbar wieder steckengeblieben in der Grauzone des labilen Pluralismus mit der gleichermaßen unklaren Perspektive, sich entweder auf die liberale Demokratie zuzubewegen oder die Politik der dominanten Macht zu restaurieren und einen Autoritarismus nach russländisch-belarussischem Vorbild zu errichten. Auch wenn man die Niederlage der Revolution anerkennen muss, hat die Ukraine eine gute Chance, sich zumindest die Perspektive einer evolutionären Entwicklung zu bewahren, wohin sie die Orangene Revolution trotz allem führte. Wie es auch immer sei, aber dank der Revolution haben die Ukrainer mehr oder weniger die Macht, die sie verdienen. Das betrifft die sogenannte „prorussische“ autoritäre Partei der Regionen, die den russifizierten Süden und Osten fest unter ihrer Kontrolle hat, landesweit aber auch zusammen mit den Kommunisten nicht die erforderliche Mehrheit erreicht, um eigenständig eine Regierung zu bilden. Das betrifft aber auch die Parteien des „orangenen“ Lagers, die bereits das zweite Mal in Folge über eine knappe Mehrheit der Parlamentssitze verfügen, durch ihre innere Zerstrittenheit aber große Schwierigkeiten haben, eine stabile und arbeitsfähige Regierung zu bilden. Es heißt, jedes Volk habe die Macht, die es verdient. Per se ist das ein grausamer und ungerechter Ausspruch, denn in Wirklichkeit ist das Volk eine Abstraktion, wohingegen die einzelnen Menschen, die in ihrer Gesamtheit das Volk bilden, durchaus eine jeweils unterschiedliche Macht verdienen – manch einer eine viel bessere, ein anderer eine viel schlechtere. Nehmen wir Stalin, dem bis heute nicht nur die meisten Russen, sondern auch nicht wenige Ukrainer nachtrauern. Aber das „Durchschnittsvolk“ hat in der Tat die Macht, die es verdient, es braucht nur die Kraft, diese Macht zu wählen und wieder zu wählen und alles zu äußern, was es über sie denkt – mündlich und schriftlich, privat und öffentlich. Diese Abhängigkeit kann man mit dem Gesetz der kommunizierenden Röhren verdeutlichen. Der Wasserstand in beiden Röhren, also die Haltung der politischen, kulturellen und moralischen Eliten und die Haltung der Bevölkerung, werden sich nicht erheblich unterscheiden, wenn die beiden Röhren nur miteinander verbunden bleiben: über regelmäßige Wahlen, freie Medien, ein unabhängiges Gerichtswesen. Fast ein Jahrzehnt hatten die Ukrainer die Macht, die sie verdienten. Sowohl 1991 als auch 1994 bestimmten sie ihren Präsidenten aus einer ziemlich großen Anzahl an Kandidaten in ziemlich freien und fairen Wahlen. Sie hatten ausreichend bürgerliche Freiheiten, um „für“ oder „gegen“ einen Kandidaten einzutreten. Verloren ging die Verbindung zwischen den kommunizierenden Röhren Ende der 1990er Jahre, als sich der damals extrem unpopuläre Leonid Kučma entschloss, um eine zweite Amtszeit zu kämpfen, wofür er mit allen Wahrheiten und Unwahrheiten sämtliche Kandidaten aus dem Weg räumte – bis auf den ungefährlichsten (weil noch schrecklicheren), den Kandidaten der Kommunisten. Indem er die Ukrainer ihrer realen Wahl beraubte, hatte er ihnen das Recht auf die Macht genommen, die sie verdienen. Eine Macht, für die sie – und nur sie – die Verantwortung tragen und für deren Wahl sie niemandem außer sich selbst die Schuld geben können. Die Orangene Revolution stellte die Verbindung zwischen den Röhren wieder her – zwischen der Gesellschaft, die langsam, aber sicher zu einer Bürgergesellschaft geworden ist, und den Eliten, die in den letzten Kučma-Jahren auf das Niveau autoritärer Dritte-Welt-Regimes herabgesunken waren. Nach der Orangenen Revolution hatte die Ukraine wieder die Macht, die sie verdient: äußerlich orange und ihrem Wesen nach sowjetisch. Den Orangenen Kräften (und dem ihnen zugeneigten Teil der Gesellschaft) gelang es in den anderthalb Jahren nicht, dieses Wesen zu verändern, kamen 2006 doch erwartungsgemäß die Donec’ker an die Macht, die dieses sowjetische Wesen verkörpern und reproduzieren und nun auf ihre Weise ausfüllen. Aber auch den Donec’kern ist es in dem einen Jahr nicht gelungen, die autoritäre Macht nach dem Kučma-Modell wiederherzustellen. Mit ihren ursupatorischen Bestrebungen haben sie indessen eine Krise heraufbeschworen und – folgerichtig – die vorgezogenen Wahlen am 30. September 2007 verloren. Es wäre naiv zu glauben, das Niveau der Eliten könnte merklich höher sein als das Niveau der Gesellschaft, deren Teil sie sind. Noch naiver ist es zu denken, man könnte das Niveau schnell verändern. Die Verbindung zwischen den kommunizierenden Röhren allerdings, zwischen Macht und Gesellschaft, ist eine notwendige (wenn auch keine hinreichende) Bedingung für demokratische Veränderungen. Trotz ihrer institutionellen Schwäche, der fehlenden rechtsstaatlichen Tradition, des Partikularismus beziehungsweise Parochialismus der Eliten und der ungenügenden Reife der Zivilgesellschaft verfügt die Ukraine weiterhin über eine recht hohe gesellschaftliche Dynamik und Offenheit des politischen Systems, über freie Massenmedien und zivilgesellschaftliches Engagement der Bürger, um die demokratischen Institutionen und Verfahren schrittweise zu verbessern. Bildlich gesprochen erinnert also das Wasser in den ukrainischen kommunizierenden Röhren an fauliges Wasser in einem Aquarium. Die Orangene Revolution hatte versucht, es zu auswechseln, indem sie die innere Zirkulation zwischen den Röhren wiederherstellte. Das Wasser ist aber bereits wieder trübe geworden, was lediglich heißt, dass man es immer wieder wechseln muß – mit Hilfe von Wahlen, freien Medien, eines unabhängigen Gerichtswesens und zivilgesellschaftlichem Engagement – so lange, bis es wieder mehr oder weniger klar ist. Pfadabhängigkeit Vor etwas mehr als zehn Jahren zeigte Robert Putnam in seiner zu einem Klassiker gewordenen Arbeit Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (1994) überzeugend die Abhängigkeit der Entwicklung unterschiedlicher Regionen von ihrem historischen Erbe, insbesondere von ihren zivilgesellschaftlichen Traditionen, die er als „Sozialkapital“ bezeichnet: Sozialkapital ist der Grad des Vertrauens der Bürger untereinander und ihre Fähigkeit, auf der Basis gegenseitigen Vertrauens miteinander zu agieren, um gemeinsame, für die Gesellschaft bedeutsame Ziele zu erreichen. Im Mittelpunkt seiner Beobachtungen stand die Verwaltungsreform, die in Italien in den 1970er Jahren durchgeführt wurde. Putnam fand heraus, wie unterschiedlich dieselbe Reform und dieselben Institutionen im Süden und im Norden des Landes in einem signifikant unterschiedlichen sozialen Umfeld funktionierten. Der Norden und der Süden haben eine unterschiedliche Geschichte; sie gehörten praktisch zu unterschiedlichen Zivilisationen, innerhalb derer sich verschiedene politische Kulturen herausgebildet haben – eine demokratisch-republikanische im Norden und eine autoritär-patrimoniale im Süden mit einem entsprechend unterschiedlichen Niveau an Sozialkapital. Daraus zieht Putnam den beunruhigenden Schluss: Das Schicksal Süditaliens ist eine sichtbare Lektion für die Länder der Dritten Welt heute und für die ehemals kommunistischen Länder Eurasiens morgen, die sich unsicher auf ihre Selbstverwaltung zubewegen. […] Viele der ehemals kommunistischen Länder hatten schwache zivilgesellschaftliche Traditionen, bevor der Kommunismus errichtet wurde, und der Totalitarismus hat diese ohnehin schwachen Elemente von Sozialkapital ganz vernichtet. Ohne Reziprozitätsnormen und zivilgesellschaftliche Netzwerke ist in Süditalien eher eine Hobbessche Entwicklung – amoralischer Familismus, Klientelismus, Gesetzlosigkeit, ineffiziente Verwaltung und wirtschaftliche Stagnation – wahrscheinlich als eine erfolgreiche Demokratisierung und ein wirtschaftlicher Aufschwung. Palermo zeigt uns möglicherweise das Moskau von morgen. Insgesamt ist die Entwicklung jedes Landes abhängig von seiner Geschichte, seinen kulturellen Traditionen und seiner Zugehörigkeit zu einer Zivilisation. Die Pfadtheorie, die behauptet, dass der Punkt, an dem man ankommt, abhängig ist von dem Punkt, an dem man losgegangen ist, hört sich etwas deterministisch, aber nicht fatalistisch an. Der Präsident der Provinz Basilikata, so schreibt Putnam, kann seine Regierung wirklich nicht nach Emilia verlegen, also vom Süden in den Norden Italiens. Und genauso wenig kann der Ministerpräsident von Aserbajdžan sein Land an die Ostsee verlegen. Es geschehen keine Wunder, augenblickliche Veränderungen finden nicht statt. Das bedeutet aber keineswegs, dass sich nichts verändern lässt und alle Bemühungen vergebens sind. Die Vergangenheit determiniert tatsächlich im großen Umfang die Zukunft. Glücklicherweise determiniert sie diese nicht vollständig, sondern lässt einen ziemlich breiten Korridor an Möglichkeiten, den man mit energischen, zielgerichteten Bemühungen noch stark erweitern, aber auch stark einschränken oder völlig verspielen kann. Die Orangene Revolution hat den Korridor der Möglichkeiten für die ukrainische Gesellschaft bedeutend erweitert, die doch mit einem sowjetischen Erbe belastet ist, das weitaus schwerer wiegt als das kommunistische Erbe der DDR. Bislang konnten allerdings weder die Gesellschaft noch ihre orangenen Führer umfassend von diesen neuen Möglichkeiten Gebrauch machen. 2006 verengte sich der Korridor fatal, wohingegen die Parlamentswahlen 2007 als verzweifelter Versuch verstanden werden kann, ihn wieder zu erweitern oder zumindest seiner weiteren Verengung infolge des autoritären Drucks durch die Partei der Regionen zuvorzukommen. „Die Ukrainer müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen“, schrieb James Sherr nach dem Parlamentsstreich im Juli 2006: Es geht im Grunde genommen um die Sicherung der Demokratie in der Ukraine, um die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, also um die Grundfreiheiten, die die Existenzbedingungen für alle Parteien im System sichern und den Sieg der Partei der Regionen legitimieren. Die größte Herausforderung besteht darin, der Partei der Regionen bewusst zu machen, dass zwischen der „administrativen Ressource“ – ihrer natürlichen Versuchung – und der Legitimierung – ihrem vitalen Interesse – ein Widerspruch besteht. Idealerweise sollte auch jemand die Partei der Regionen davon überzeugen, den Einsatz finanzieller Ressourcen als Machtmittel abzulehnen. Leider leben wir nicht in einer idealen Welt, und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemandem gelingt, geht gegen null. Es ist schwierig genug, an die Interessen zu appellieren, die die Partei der Regionen vertritt. Es ist unmöglich, an Interessen zu appellieren, die sie nicht vertritt. […] Die Niederlage ist ein grausamer Lehrer. Sie hat auch ihren Nutzen. Sie eröffnet die Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen, zum Anfang zurückzukehren und mit tieferem und besserem Wissen einen erneuten Versuch zu unternehmen. Dank der vorgezogenen Wahlen haben die orangenen Parteien von der Gesellschaft eine weitere Chance erhalten, das Land auf einen demokratischen Weg zurückzuführen und die notwendigen institutionellen Reformen anzustoßen. Die knappe Mehrheit im Parlament von 228 der 450 Sitze macht ihre Regierungskoalition wackelig. Die inneren Streitigkeiten und Konflikte zwischen den Parteiführern können gut und gern zu einer Wiederholung des Szenarios von 2005 führen. Damals hatte Präsident Juščenko die Kompetenzen von Julija Tymošenko als Ministerpräsidentin stark beschnitten, indem er einige Schlüsselpositionen, insbesondere im Energiesektor, mit eigenen Leuten besetzte und sie damit faktisch der Kontrolle der Ministerpräsidentin entzog. Andererseits schob er die gesamte Verantwortung für die vermeintliche Ineffizienz der Regierung der Ministerpräsidentin zu, obwohl die Korruptionsvorwürfe gerade an seine Leute gerichtet worden waren und Julija Tymošenko sich wiederholt gerade über die Sabotage aus dem Juščenko-Lager beschwerte. Nicht wenige Experten in der Ukraine und im Ausland sind der Meinung, dass eine gemischte, „orange-blaue“ Koalition zwischen Naša Ukraïna und der Partei der Regionen die bessere Lösung wäre. Sie, so wird behauptet, könne die Spaltung zwischen „orangenem“ Zentrum und Westen und „blauem“ Süden und Osten überwinden helfen und die Partei der Regionen zu einem vollwertigen und verantwortlichen Beteiligten an den politischen und ökonomischen Reformen machen. Gegner dieser Idee merken an, dass die Partei der Regionen aber keine „normale“ Partei, sondern eher der politische Flügel des Donec’ker Klans (einfacher gesagt: der lokalen Mafia) sei. Und ihr Verhalten an der Macht erinnert am ehesten an das Verhalten der kommunistischen Parteien in den Regierungskoalitionen im Osteuropa der Nachkriegszeit. Genau so hat sie sich im vergangenen Jahr verhalten, als der Machtmissbrauch und der Kauf „fremder“ Abgeordneter beinahe zum Tagesgeschäft gehörten und dadurch den überaus besonnenen (oder, wie viele glauben, unentschlossenen) Präsidenten Juščenko zur Auflösung des korrupten Parlaments veranlassten. Die Hauptaufgabe, vor der sich die politischen Kräfte der Ukraine heute sehen, besteht nicht darin, die Partei der Regionen an der Macht zu beteiligen, sondern den Oppositionsstatus einer Partei als etwas Normales und nicht als eine Katastrophe für die Politiker und insbesondere ihre Geschäftspartner zu begreifen. Die Institutionalisierung der Opposition wäre der erste wirklich eindeutige Schritt weg von der postsowjetischen Wirklichkeit hin zur Aneignung europäischer Spielregeln in der Politik. Dafür sind allerdings eine grundlegende Reform des Gerichtswesens und die Festigung des Rechtsstaates in institutioneller und mentaler Hinsicht erforderlich. Das ist kein einfacher und schneller Prozess, aber es scheint so, als hätte sich die Mehrzahl der politischen und – was besonders wichtig ist – ökonomischen Akteure in der Ukraine dem Verständnis angenähert, dass diese Institutionalisierung unabdingbar ist. Regionale und andere Teilungen der Ukraine stehen der Macht- und Ressourcenmonopolisierung, gleich welcher politischen Kraft (oder eines Oligarchenklans), entgegen und machen demnach ein Regime der „gelenkten Demokratie“ nach russischem oder zentralasiatischem Muster unmöglich. Die Demokratie in der Ukraine ist dazu verurteilt, „ungelenkt“ zu sein, genauer gesagt, die ukrainische Gesellschaft und die ukrainischen Politiker sind dazu verurteilt, sie selbst zu lenken, und zwar durch eigene Institutionen und nicht durch einen autoritären Führer von außen. Vor der Ukraine liegt tatsächlich der schwierige Übergang vom „erzwungenen Pluralismus“ zum reflektierten und institutionalisierten Pluralismus. Der Übergang ist im Prinzip unausweichlich, aber er kann sich über Jahre hinziehen, er kann sich aber auch – wie in anderen osteuropäischen Ländern – ziemlich schnell vollziehen, wenn nur die Europäische Union die ukrainischen Bemühungen zur Kenntnis nehmen und entsprechende Unterstützung gewähren würde. Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe, Jena
Volltext als Datei (PDF, 188 kB)