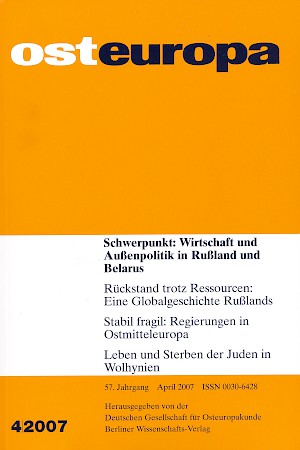Rußlands Wille zur Weltmacht
Autokratie, Energie, Ideologie
Volltext als Datei (PDF, 146 kB)
Abstract in English
Abstract
Rußlands Außenpolitik gleicht einem Zickzackkurs. Die Politik des Kreml bewegt sich zwischen Kooperation und Konfrontation, der Westen ist gleichzeitig Partner und Gegner. Trotz gleicher ökonomischer Interessen werden die Wertedifferenzen immer deutlicher. Vor allem im postsowjetischen Raum kollidieren die Vorstellungen. Zunehmend imitieren Rußland und der Westen die „strategische Partnerschaft“. Schuld daran sind die Konsolidierung des bürokratischen Autoritarismus unter Putin sowie die mangelnde Kohärenz westlicher Politik. Um eine stabile Partnerschaft zu schaffen, sind eine Abkehr der USA vom militärgestützten Hegemonialstreben und der Übergang Rußlands zu demokratischen Standards erforderlich.
(Osteuropa 4/2007, S. 33–52)
Volltext
„Rußland kehrt zum imperialen Paradigma einer Großmacht zurück“, sagen die einen. „Nein, Rußland durchlebt gerade das postimperiale Syndrom, das alle ehemaligen Imperien durchgemacht haben. Früher oder später wird Rußland anfangen, eine ausgewogene Politik zu machen“, erwidern die anderen. Was ist also die Logik der Außenpolitik Rußlands am Ende der Regierungszeit Vladimir Putins? Und was sind ihre Ziele? Noch im Februar 2000 dachte Vladimir Putin über die Integration Rußlands in die NATO und die EU nach. Er wollte offensichtlich in die Geschichte eingehen als jener, der den Durchbruch Rußlands nach Westen schaffte. Heute überrascht der Kreml die Welt damit, daß Rußland selbständig und aggressiv agiert. Der Kreml ist bereit, seinen Dissens mit dem Westen zu demonstrieren und sucht nach Wegen, die westlichen Staaten aus dem Gebiet zu drängen, das Moskau als eigene Einflußsphäre betrachtet. Auch in anderen Regionen der Welt will Rußland wieder eine Rolle spielen und kehrt zu globalen Ambitionen zurück. Was sind die Gründe für dieses unerwartete Selbstvertrauen Rußlands? Da sind zunächst der hohe Ölpreis und die Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen. Die stabile innenpolitische Lage und Putins große Popularität in der Gesellschaft spielen ebenfalls eine Rolle. Dazu kommen externe Faktoren: Die Uneinigkeit in der westlichen Gemeinschaft, wie die Sicherheit der westlichen Zivilisation zu garantieren sei, der Mißerfolg der USA im Irak, die Unzufriedenheit der Welt mit dem amerikanischen Hegemoniestreben sowie die „farbigen Revolutionen“ in Georgien und der Ukraine, die 2003–2005 die rußländische Elite aufgeschreckt hatten. Dies gab dem Selbstwertgefühl der rußländischen Elite Auftrieb und ließ ihr Interesse am globalen Machtspiel wieder aufleben. Diese Elite scheint an Rußlands Potential auf der internationalen Bühne zu glauben. Vielleicht blufft sie jedoch auch nur. Denn die Innenpolitik, die auf Simulation beruht, könnte eine Außenpolitik nach sich ziehen, die auf gleiche Weise zur Schaffung „Potemkinscher Dörfer“ neigt. Moskaus Selbstbewußtsein verstärkt das Mißtrauen zwischen Rußland und dem Westen. Wie konnte es dazu kommen und war das unvermeidlich? Es gibt eine Menge Gründe, die vertrauensvolle Beziehungen zwischen Rußland und dem Westen erschweren. Der Hauptgrund ist struktureller Art. Rußlands Staatsverständnis ist dem Westen fremd. Daher begegnet er dem rußländischen Großmachtdenken mit Mißtrauen. Das Streben nach globalem Einfluß war im 20. Jahrhundert eine stetige Quelle von Konfrontationen zwischen der UdSSR und den liberalen Demokratien. Rußlands Distanzierung vom Westen hat auch politische Gründe. Erstens bleibt das Großmachtdenken für die rußländische Elite ein wichtiger Faktor der Selbstidentifikation. Sogar die Liberalen meinen, daß Rußland aufgrund seiner geographischen Lage und seiner Sicherheitsinteressen kein „normales Land“ sein könne und es auf jeden Fall nach weltweitem Einfluß streben solle. Die rußländische politische Klasse ist nicht bereit, das Hegemoniestreben der USA anzuerkennen, wie es die atlantischen Verbündeten Amerikas tun. Zweitens nutzt der Kreml immer aktiver antiliberale Traditionen, um das politische Regime zu stabilisieren. Drittens erfordert die Entwicklungsdynamik des rußländischen Systems eine Politik der Stärke, die Moskau heute auf der Basis der Verfügungsgewalt über Energieressourcen betreibt. Für die Machtreproduktion des Kremls ist es unerläßlich, diese Stärke in der Weltpolitik zu demonstrieren. Denn ein schwacher Staatschef, der keine Initiativen auf der internationalen Bühne ergreift, die für die Selbstbestätigung der rußländischen Elite immer enorm wichtig war, hat keine Chance, die Ereignisse im eigenen Land zu kontrollieren. Viertens glaubt die rußländische politische Klasse, daß es ein Verzicht Rußlands auf seine Souveränität bedeuten würde, wenn es sich auf den Westen zubewegte. Aber auch die westliche Staatengemeinschaft ist dafür verantwortlich, daß die Annäherung Rußlands an den Westen ins Stocken geraten ist und die Entfremdung wieder wächst. Der einzige Staatschef, der die Umgestaltung Rußlands und seine Eingliederung „in den Westen“ zur Priorität seiner Außenpolitik gemacht hatte, war Bill Clinton. Er sah Reformen in Rußland als eine Garantie für weltweite Stabilität und amerikanische Sicherheit: Rußland muß für uns Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit sein […] Die Welt kann es sich nicht erlauben, daß sich das Drama Jugoslawiens im Falle eines Staates wie Rußland wiederholt, der über ein atomares Potential verfügt und sich über elf Zeitzonen erstreckt. Zwar gelang es Rußland, die Wiederholung dieses katastrophalen jugoslawischen Szenarios zu verhindern. Doch die westliche Staatengemeinschaft fand keine befriedigende Antwort auf die rußländische Herausforderung. Dies hatte verschiedene Gründe. Einen brachte Robert Legvold auf den Punkt: Das Problem besteht darin, daß weder die politischen Führer der USA noch diejenigen Europas sich ernsthaft mit der Herausforderung auseinandergesetzt haben, wie man Rußland in den Westen integrieren kann, wenn Rußland als nicht integrierbar galt und weder Mitglied der EU noch der NATO werden konnte. Nicht minder wichtig ist, daß die Mehrheit der westlichen Staatschefs sich nicht bewußt war, wie schwierig es sein würde, einen neuen rußländischen Staat zu schaffen. Ein Teil schaute interessiert zu, wie der gestern noch so mächtige Gegner im Wasser zappelte und nicht wußte, wohin er schwimmen sollte. Der andere Teil des Westens versuchte aufrichtig, Rußland zu helfen und ihm die Anpassung an die neue Realität zu erleichtern. Aber auch denjenigen, die das Ausmaß der Herausforderung erkannt hatten, gelang es nicht, die Transformation in Rußland effektiv zu unterstützen. Europa und Amerika entwickelten keine gemeinsame Strategie, um Rußland einzubinden. Es mangelte an Verständnis für die Widersprüchlichkeit der politischen Entwicklung in Rußland, und die politischen Akteure wurden naiv beurteilt. Die Mißerfolge der rußländischen Reformen in den 1990er Jahren enttäuschten den Westen, beunruhigten ihn aber nicht weiter, denn viele aus dem westlichen Establishment hatten Rußland als Feind oder als Störenfried von ihrer Agenda gestrichen. Sie betrachteten die Stagnation in Rußland als etwas Unvermeidliches, was den Westen jedoch nicht weiter bedrohe. Die Wiedergeburt Rußlands als globaler Akteur kam für die westlichen politischen Kreise völlig unerwartet. Dies war die Folge von konzeptionellen, politischen und diplomatischen Fehleinschätzungen. Bis heute haben westliche Politiker nicht begriffen, welchen Anteil der Westen an der Entwicklung in Rußland spielte und wie er das Mißtrauen in Rußland verstärkte, insbesondere durch die Bombardierungen Serbiens, die Erweiterung der NATO, den Irak-Krieg und durch Doppelstandards. Es ist daran zu erinnern, daß unter Michail Gorbačev der Systemwandel mit dem neuen außenpolitischen Denken begonnen hatte. Gorbačev zerstörte das Feindbild vom Westen, indem er die Konfrontation beendete und mit ihm in einen Dialog eintrat. Unter Putin hat ein Rollback eingesetzt. Die Außenpolitik ist zu einem Instrument zur Stärkung des bürokratischen Autoritarismus geworden. Erneut ist es opportun, den Westen als Feind zu sehen. Rußlands Außenpolitik dient immer mehr als Mittel für innenpolitische Zwecke. Warum ist das so? Offenbar deshalb, weil die innenpolitischen Quellen des bürokratischen Autoritarismus versiegen. Welche internationalen Aktivitäten Rußlands man auch immer betrachten mag – sei es die Unzufriedenheit mit dem amerikanischen Hegemoniestreben, sei es den Verkauf von Rüstungsgütern an Syrien, Venezuela oder den Iran, sei es die Nachsicht gegenüber dem iranischen Nuklearprogramm, sei es den Druck auf die Ukraine und Georgien –, immer läßt sich eine Verbindung mit den innenpolitischen Bedürfnissen des Regimes erkennen. Ein Beispiel: Außenpolitisch müßte es Rußland dahin drängen, ein Tandem mit den USA zu bilden, z.B. gegen den internationalen Terrorismus oder potentiell gegen China. Aber innenpolitisch benötigt der Kreml einen mächtigen Gegner, um die Aufrechterhaltung eines zentralisierten Staates zu rechtfertigen. Unter Putin durchlief die Außenpolitik eine bemerkenswerte Entwicklung. Putin hatte seine erste Amtszeit mit dem Versuch unternommen, eine Partnerschaft mit den entwickelten Demokratien einzugehen. Nachdem das Vertrauen in die eigenen Stärken gewachsen war und sich erste Enttäuschungen über die ausländischen Partner eingestellt hatten, experimentierte der Kreml mit der Multipolarität. Das führte zu erheblichen Schwankungen. Der Übergang zur Multipolarität war Ausdruck des Wunsches, freie Hand haben zu wollen. 2005 begann eine neue Phase. Der Kreml beschloß eine ambitioniertere Außenpolitik. Ausdruck dessen war der Versuch, den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu beeinflussen. 2006 versuchte Außenminister Sergej Lavrov, Rußland als Vermittler in Konflikten weltweit ins Spiel zu bringen. Im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen dem Iran und der Hamas sowie den westlichen Ländern erklärte er: Rußland […] kann sich in dem globalen Konflikt der Kulturen nicht auf eine Seite schlagen […] Rußland ist bereit, die Rolle einer Brücke zu übernehmen. Erstmals seit 15 Jahren verkündete der Kreml, Rußland weigere sich, sich der westlichen Zivilisation anzuschließen. Das kommt einer Revision der strategischen Position Rußlands gleich. Ende 2006 postulierte Lavrov das Ziel, ein „geopolitisches Dreieck“ aus Rußland, der EU und den USA zu bilden. Kurz danach plädierte er für eine „Netzwerk-Diplomatie“. Den heutigen Herausforderungen könne man nicht mehr mit sperrigen Bündnissen und festen Verpflichtungen, sondern nur mit Zweckbündnissen gerecht werden, die den jeweils anderen Interessen und Machtverhältnissen entsprechen. Eine solche „Netzwerk-Diplomatie“ solle „flexible bilaterale Beziehungen“ zwischen den Staaten ermöglichen. Dies paßt zwar ideal zu Rußlands zivilisatorischer Unbestimmtheit. Aber die Betonung der Flexibilität paßt nicht zur Idee des „geopolitischen Dreiecks“, das offenbar ein dauerhaftes Gebilde sein soll. Die bloße Auflistung der vom Kreml benutzten Begriffe – „Netzwerk-Diplomatie“ „Mittler“, „Brücke“, „geopolitisches Dreieck“ und schließlich „Energie-Supermacht“ – illustriert, welche neue Stimmung unter der rußländischen Elite herrscht. Sie versucht, sich alle Möglichkeiten offenzuhalten, um sich in unterschiedliche Richtungen bewegen zu können und vermeidet dabei, auch nur eine einzige Verpflichtung einzugehen. Einerseits geht es um eine eigenständige Rolle Rußlands zwischen dem Westen und der restlichen Welt. Andererseits möchte Moskau sich einen Platz im Triumvirat mit den USA und der EU sichern. Im selben Moment offenbart Moskau mit der Betonung Rußlands als „Energiemacht“ ein Machtverständnis, das einer Rückkehr zum geopolitischen Denken des 19. Jahrhunderts gleichkommt – im Stile der im Westen fast vergessenen Geopolitiker Halford Mackinder oder Nicholas Spykman. Angeblich geht es um eine Geopolitik neuen Typs, die Energie-Geopolitik. Während unter Boris El’cin die Idee, sich an westlichen Werten auszurichten, in der damals herrschenden politischen Klasse wenig Protest hervorgerufen hatte, betrachten rußländische Politiker heute jede Anleihe aus dem Westen als „ideelle Grundlage des Defätismus“ und „Absage an die eigene Identität und Souveränität“. Beflissene Kreml-Propagandisten erklären inzwischen, daß der Westen, in erster Linie die USA – unter dem Deckmantel des Kampfes für Demokratie und Menschenrechte in Rußland – danach strebe, Rußland „der einzigartigen Rolle zu berauben, die es auf den Weltmärkten der Energieressourcen spielt“. Folglich müsse sich Rußland mit aller Kraft vor dem westlichen Einfluß schützen und das westliche, in erster Linie amerikanische Verständnis von Demokratie bekämpfen. Im politischen Bewußtsein der rußländischen Elite setzt sich zunehmend die Sichtweise durch, daß die umgebende Welt Rußland feindlich gesonnen sei. Die heutige politische Klasse zweifelt schon nicht mehr daran, daß der Westen eine aggressive Macht ist, die Rußland Böses will. Die Ereignisse in der Ukraine waren der Anlaß für diese Schlußfolgerung. Die Orangene Revolution Ende 2004 und Moskaus mißglückter Versuch, die ukrainischen Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, waren der erste Konflikt zwischen Rußland und dem Westen im postsowjetischen Raum. Rußland geriet mit dem Westen aufgrund der zivilisatorischen Unterschiede aneinander – die Geopolitik war hier zweitrangig. Das politische Moskau ist aufrichtig davon überzeugt, daß das ukrainische Volk auf den Majdan in Kyïv strömte, weil der Westen es verleitet und bezahlt hat. Doch die Ereignisse zeigten auch, daß Rußland für eine Konfrontation mit dem Westen nicht gerüstet ist – Moskau mußte nachgeben. Ungeachtet dieses Mißerfolgs hielt die rußländische politische Klasse an der Überzeugung fest, daß Rußland nicht nur das Recht habe, die neuen Spielregeln auf der Weltbühne mitzubestimmen, sondern ihnen den eigenen Stempel aufzudrücken. Inwiefern sind diese Ambitionen gerechtfertigt, und auf welche Ressourcen kann sich der Kreml dabei stützen? Moskaus Vermittlungsversuche in den Konflikten zwischen dem Westen und Nordkorea oder dem Westen und dem Irak scheiterten, ganz zu schweigen von den mißglückten Versuchen, die Konflikte in Transnistrien, Abchasien und Südossetien zu lösen. Angesichts der Art und Weise, wie der Kreml Anfang 2006 agierte, als nach dem Wahlsieg der Hamas die EU und die USA eine Finanzblockade gegen die Palästinensische Autonomiebehörde verhängten, entsteht der Eindruck, daß es sich um spontane Initiativen handelt, die lediglich auf einen demonstrativen Effekt zielen, nach dem Motto: „Ergebnis hin oder her – Hauptsache Aufsehen erregen!“ Zugleich kann sich der Kreml taktischer Erfolge rühmen. So hat Rußland seine Präsenz im postsowjetischen Raum verstärkt und den Westen dazu gezwungen, bei globalen Fragen stärker auf Moskau Rücksicht zu nehmen. Die westlichen Regierungen ziehen es vor, den Kreml nicht zu verärgern, da sie wissen, daß ohne Moskau die wichtigsten Probleme nicht gelöst werden können, angefangen von der Energiesicherheit bis zur nuklearen Nichtverbreitung. Einige europäische Staatschefs verfolgen die Politik, sich beim Kreml einzuschmeicheln. Sie sind bestrebt, bilaterale Beziehungen aufzubauen, und verschaffen so Rußland einen größeren Handlungsspielraum gegenüber dem Westen. 2005 nahm das Verhältnis Rußlands zum Westen die Form einer antagonistischen Partnerschaft an. Das bedeutet in einigen Bereichen Kooperation, in anderen Eindämmung. Rußland möchte gleichzeitig „auf der Seite des Westens sein, aber nicht unbedingt Teil des Westens, dann wieder ohne ihn und vielleicht sogar gegen ihn.“ Von außen betrachtet ist diese hybride Außenpolitik natürlich Nonsens. Aber faktisch kommt darin das Bemühen des Kremls zum Ausdruck, die hybride Innenpolitik auf die Außenpolitik zu übertragen. Wahlen und Alleinherrschaft sind ebenso wenig miteinander vereinbar wie mit dem Westen zu gehen, aber auf einem anderen Weg und gleichzeitig für den Westen und gegen ihn zu sein! Bei einem so widersprüchlichen Verhaltensmodell ist die Frage nach Rußlands strategischer Orientierung, über die sich Politikwissenschaftler und Politberater so lange den Kopf zerbrochen haben, nicht zu beantworten. Im Moment der Wahrheit, nach dem 11. September 2001, hatte der Kreml sich zwar eindeutig an die Seite der USA gestellt. Das spricht dafür, daß Rußland sich in existentiellen Augenblicken höchstwahrscheinlich für den Westen entscheiden wird. Aber in Friedenszeiten wird das Russische System aus Alleinherrschaft und Großmachtstreben aufrechterhalten, und das Land kehrt unvermeidlich zu seiner schwankenden Haltung zurück. Die Frage ist, wie lange Moskau diese Mischung aus Realpolitik, wirtschaftlichem Pragmatismus, dem Wunsch, Mitglied im Klub der westlichen Demokratien zu sein, und dem Großmachtstreben aufrechterhalten kann. Die Hybridität der rußländischen Außenpolitik spiegelt sich auch im politischen Stil wider. Er ist eine Mischung aus Druck und – wo Hindernisse auftauchen – Rückzug, aus Selbstvertrauen und Unsicherheit, dem Streben, in allen internationalen Gremien mitwirken zu wollen, doch gleichzeitig Verpflichtungen auszuschlagen, Aktivitätsschüben und fehlenden strategischen Zielen. Eine solche Politik macht es dem Westen natürlich schwer, eine kohärente Politik gegenüber Rußland zu entwickeln und zwingt ihn mitunter, den rußländischen Zickzackkurs mitzumachen. Auf globaler Ebene möchte Rußland den status quo aufrechterhalten. Es ist übrigens dasselbe Ziel, das die politische Elite auch in der Innenpolitik verfolgt. Rußland versucht, jene Elemente des internationalen Systems zu bewahren, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind und die es Rußland ermöglichen, die Rolle einer Weltmacht zu spielen. Das gilt etwa für den Sicherheitsrat der UNO mit Rußland als Ständigem Mitglied und Vetomacht oder für den ABM-Vertrag als Teil des nuklearen Abschreckungssystems. Der Kreml will die Nachkriegsordnung bis zu dem Moment aufrechterhalten, an dem er sich stark genug fühlt, eine neue Weltordnung maßgeblich mitzubestimmen. Wie im 19. und 20. Jahrhundert übernimmt Rußland die Rolle des konservativen Wächters. Es gibt ein weiteres Land, das am Erhalt des status quo interessiert ist: China. Auch das Reich der Mitte will die jetzige Situation beibehalten, bis es genügend Kraft gesammelt hat, um der Welt seine eigenen Bedingungen zu diktieren. Hier decken sich die Interessen Rußlands und Chinas. Aber in Zukunft wird Chinas Aufstieg das globale Gleichgewicht der Kräfte unvermeidlich ändern. Das wird auch Rußland betreffen, höchstwahrscheinlich nicht zu seinen Gunsten. Das Bestreben des Kremls, gleichzeitig Partner und Gegner des Westens zu sein, treibt absurde Blüten. So erarbeitet Moskau mit der EU einerseits das Konzept der „Vier Räume“, um sich an die EU anzunähern. Andererseits betrachtet der Kreml die Annäherung der Ukraine an die EU als feindseligen Akt. Einerseits hatte Rußland 2006 den Vorsitz der G8 inne, andererseits beschuldigt es weiterhin den Westen, seine territoriale Integrität zu untergraben. Auf der einen Seite hält Moskau die USA für einen Partner in der Antiterror-Koalition, auf der anderen Seite fordert es, daß die Amerikaner aus Zentralasien abziehen, obwohl es immer mehr zum Hort des Terrorismus wird. Einerseits versucht Putin, westliche Investitionen nach Rußland zu holen, andererseits geht dies mit antiwestlicher Propaganda und der Verstaatlichung des Vermögens westlicher Investoren einher. Doch indem sich Rußland vom Westen entfernt, stärkt es keineswegs seine Souveränität. Vielmehr gerät es in die Einflußsphäre Chinas, insbesondere durch die Teilnahme an der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), welche die Chinesen nutzen, um nach Zentralasien zu expandieren und die USA zu bekämpfen. Moskau bemerkt nicht, wie Peking die Partnerschaft mit Rußland nutzt, um seine eigenen Interessen zu verfolgen. Peking erlaubt aber Moskau zugleich, der Illusion weiter anzuhängen, der führende Partner in ihrer Partnerschaft zu sein. Wie weit aber wäre Moskau bereit, einen selbständigen Kurs einzuschlagen? Die Antwort liegt auf der Hand: Der überwiegende Teil der rußländischen Elite ist nicht zur Isolation bereit und noch viel weniger zu Spannungen mit dem Westen. Wie kann das eine Elite wollen, die Milliarden von Dollars für ein besseres Image im Westen ausgibt, um westliche Investoren nach Rußland zu locken, die ihre Präsenz im Westen ausbauen will, deren Familien dort leben und die dort auch ihre Konten unterhält? Wie könnte zu einem Szenario der Distanzierung vom Westen die G8 passen und jene Energie, die Putin in die Organisation des Petersburger Gipfels 2006 steckte? Wir erleben eine Situation, in der die herrschende Elite bestrebt ist, sich auf persönlicher Ebene in den Westen zu integrieren und optimale Bedingungen für die eigenen Geschäfte zu erreichen. Doch gleichzeitig nutzt sie den Widerstand gegen den Westen zur Konsolidierung der Gesellschaft. Der Oligarch Roman Abramovič, der lange Gouverneur von Čukotka war und jetzt in Großbritannien lebt, ist dafür der Prototyp. Wie er leben zig Angehörige der herrschenden Klasse in westlichen Hauptstädten und verwalten von dort aus ihre Vermögenswerte in Rußland. Gleichzeitig unterstützen sie den aggressiven außenpolitischen Kurs des Kremls und versuchen, Nationalismus zu demonstrieren, sobald sie sich in Rußland aufhalten. Das ist nachvollziehbar, denn nur wenn sie gegen den Westen opponieren, können sie sich als vollwertig empfinden. Und in einer dem Westen feindlich gesinnten Gesellschaft können sie nur so die Elite bleiben. Der überwiegende Teil der Elite ist nicht zu einer Verschlechterung der Beziehungen Rußlands zum Westen bereit, dies könnte ja die schizophrene, aber für sie zugleich angenehme Situation der Spaltung zerstören. An dieser Haltung ist nichts neu; wir haben es mit der Wiederholung einer alten Politik zu tun. Isaiah Berlin machte sich bereits Ende der 1940er Jahre Gedanken über den „doppelten Boden“ der rußländischen Außenpolitik: Rußland ist bereit, sich an den internationalen Beziehungen zu beteiligen, aber es wünscht sich, daß sich die anderen Staaten nicht in seine inneren Angelegenheiten einmischen. Es bevorzugt es, sich von der äußeren Welt abzuschotten, möchte aber selbst nicht von ihr isoliert sein. Bislang hat die Interessengemeinschaft zwischen Rußland und dem Westen nicht zu der erwarteten Annäherung der Werte geführt. Im Gegenteil. Unterdessen zeigen sich auch Interessengegensätze. Falls Rußland in seiner heutigen Verfassung bleibt, kann es nicht der selbstverständliche Partner des Westens sein, sondern die Zusammenarbeit wird punktuell bleiben. Selbst eine gemeinsame Bedrohung wird das gegenseitige Mißtrauen nicht verschwinden lassen. Vladimir Putin ging offenbar vorübergehend davon aus, daß es ihm durch seine persönliche Diplomatie gelingen könnte, vertrauensvolle Beziehungen zu seinen westlichen Kollegen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Rußland vom westlichen Einfluß abzuschirmen. Dies ist ihm nicht geglückt. Um den Staat traditioneller Couleur bewahren zu können, muß er nun die Beziehungen zu den liberalen Demokratien aufs Spiel setzen. Kann man Koexistenz lernen? Im postsowjetischen Raum prallen verschiedene Integrationsprojekte aufeinander. Auf der einen Seite sind es Projekte rußländischen Zuschnitts, so etwa die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EURASEC), die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit (OVKS), oder der Einheitliche Wirtschaftsraum. Auf der anderen Seite sind es Projekte westlichen Zuschnitts wie die GUAM (Georgien, Ukraine, Azerbajdžan, Moldova) und die Demokratische Achse (Baltische Staaten, Ukraine, Georgien, Polen). Aber auch im Kern der GUS, der Rußland, Kazachstan und Belarus umfaßt, gibt es Widersprüche. Rußlands Integrationsprojekte sind in vielerlei Hinsicht eine Antwort darauf, daß die EU und die NATO Rußlands Grenzen nähergerückt sind. Moskaus eifersüchtige Aufmerksamkeit für den postsowjetischen Raum zeigt, daß Rußlands politische Klasse die Nachbarn, mit Ausnahme des Baltikums, immer noch als Staaten mit begrenzter Souveränität betrachtet. Für die rußländische Elite bleiben diese Staaten ein Teil der Innenpolitik. Sogar die Liberalen können sich nicht leicht von diesem traditionellen Denken lösen, wie der Aufruf von Anatolij Čubajs zeigt, Rußland zu einem „liberalen Imperium“ zu machen. Das ist ein Indiz dafür, wie schwierig es ist, sich mit der beschnittenen Gestalt des ehemaligen Imperiums abzufinden. Zwar fiel es allen Imperien schwer, sich von ihren Territorien zu trennen und der französischen und englischen politischen Klasse entschlüpften noch vor 20 Jahren imperiale Anspielungen. Staaten wie Rußland oder Großbritannien fällt es besonders schwer, sich von ihren nun unabhängigen Territorien zu lösen, da diese Staaten als Träger einer messianistischen Idee gegenüber anderen Nationen auftraten. Zugleich läßt sich das Interesse Rußlands an seinen Nachbarn nicht ausschließlich mit atavistischen imperialen Gefühlen erklären. Es speist sich aus dem Bestreben, die Bedingungen für die eigene Entwicklung sicherzustellen, Stabilität zu garantieren, wohlgesonnene Regime zu unterstützen, die wirtschaftlichen Beziehungen mit ihnen auszubauen und gemeinsam die Probleme zu lösen, die Moskau beunruhigen. Das sind etwa die Steuerung der Migration, Zollfragen, der Kampf gegen Terrorismus, Drogenhandel und Schmuggel. Der postsowjetische Raum stellt für Rußland einen Absatzmarkt für seine Waren dar, er ist ein Arbeitskräftereservoir, ein Transportkorridor sowie ein cordon sanitaire, der Rußland vor nicht immer wohlgesonnenen Staaten schützt. Rußland und seine Nachbarn verbindet nicht nur die sowjetische Vergangenheit, sondern auch eine wechselseitige Durchdringung ihrer Kulturen und die immer noch wichtige Rolle der russischen Sprache. Wenn wir anerkennen, daß es ein objektiv begründetes Interesse Rußlands am postsowjetischen Raum gibt, müssen wir uns eine Reihe von Fragen stellen: Erleichtert dieses Interesse die Modernisierung Rußlands und der anderen postsowjetischen Staaten oder behindert es dies? Tragen Rußlands Integrationsprojekte dazu bei, die Stabilität in der Region zu erhöhen oder erschweren sie dieses Ziel? In den 1990er Jahren zahlte Rußland für seine Loyalität, indem es die Ökonomien der Ex-Unionsrepubliken mit billigen Energieressourcen subventionierte. Das war aber deren Transformation keineswegs dienlich. Allerdings schwammen nicht alle Länder, die billiges Gas bekamen, auch im Fahrwasser der rußländischen Politik. Im Sommer 2005 erklärte der rußländische Außenminister Sergej Lavrov, daß es für die GUS-Staaten an der Zeit wäre, ihre Beziehungen auf der „Grundlage der weltweiten Praxis“ aufzubauen. Ein anonymer Vertreter des Kremls erläuterte, daß Moskau „der Zustand nicht gefällt, daß es die Wirtschaft seiner Nachbarn durch Energieressourcen subventioniert.“ Es wurde offensichtlich, daß Moskau eine besondere Art der Interdependenz einführen wollte: „Wenn wir dich aushalten, kannst du nicht zugleich nach anderen Ausschau halten“. Die Kommerzialisierung der Außenpolitik Rußlands sollte besser auf die politischen Zugeständnisse abgestimmt werden, zu denen die Nachbarn bereit waren. Und die Energieressourcen sollten als Basis genutzt werden, um einen neuen „Integrationsgürtel“ um Rußland zu bilden. Der „Gaskrieg“ zwischen Moskau und der Ukraine im Jahr 2005 war das erste Beispiel der neuen Politik gegenüber seinen ehemaligen „kleinen Brüdern“. Er untergrub Rußlands Ruf als zuverlässiger Energielieferant. Doch Moskau hatte nicht vor nachzugeben. Im Jahr 2007 hat Rußland für alle Nachbarn neue Preise eingeführt, sogar für jene, die als Verbündete galten: Die Ukraine kauft das Gas nun für 130 Dollar, Moldova für 170, die baltischen Länder für 240, Armenien für 110, Belarus für 100, Georgien für 235 Dollar pro tausend Kubikmeter. Die Unterschiede demonstrieren das politische Herangehen an die Preisbildung. Widerspenstige Länder zahlen mehr. Auch die loyalen Länder erhalten keine Vergünstigungen, denn für die niedrigen Energiepreise müssen sie Rußland im Gegenzug die Herzstücke ihrer Volkswirtschaften verkaufen. Nicht alle Länder waren mit der neuen rußländischen Energiestrategie einverstanden. Im Dezember 2006 begann ein neuer Konflikt – dieses Mal zwischen Rußland und seinem engsten Verbündeten Belarus, der in den nächsten „Energiekrieg“ mündete, was zur Unterbrechung der Gaslieferungen in EU-Staaten führte. Weitere Konflikte zwischen Rußland und seinen Nachbarn sind vorprogrammiert. Sie sind unvermeidlich, wenn wirtschaftliche Mittel politisiert werden. Heute geht es um Energieträger, morgen um Nickel oder Kupfer. Diese Konflikte untergraben die Souveränität der Nachbarstaaten und deren Machtapparate, womit nicht alle nationalen Eliten einverstanden sind. Eine Reihe von Staaten, die der Kreml in sein Abhängigkeitssystem einbinden will, verfügt jedoch über attraktive Alternativen. In Rußlands Einflußsphäre bleiben nur die autoritären Regime, vor allem jene, die wie Belarus in die Defensive geraten sind und keine gemeinsame Sprache mit dem Westen gefunden haben. Letzten Endes ist Moskaus Weigerung, die Nachbarn zu subventionieren, für diese sogar vorteilhaft. Sie sind gezwungen, ihre Volkswirtschaften zu reformieren, sich mit Energiesparmöglichkeiten zu befassen und andere Energiequellen zu suchen. Der Markt wird die Abhängigkeit dieser Staaten von Moskau schwächen. Georgien, das Rußlands Energiediktat fürchtet, hat bereits seine Wasserkraftwerke auf Vordermann gebracht und importiert seit 2006 keinen Strom mehr aus Rußland. Georgien hat begonnen, seine Wirtschaft zu modernisieren und die Handelsbeziehungen mit der Türkei, dem Iran und Azerbajdžan zu intensivieren. Die durch ihre Energieabhängigkeit von Rußland in eine Sackgasse geratenen Nachbarn müssen entweder nach neuen Energiequellen suchen oder aber politische Abmachungen mit Moskau treffen. So stand die ukrainische Regierung unter Viktor Janukovič im Oktober 2006 vor einem Dilemma: Entweder mußte sie Moskau politische Konzessionen machen – die Annäherung an die NATO nicht zu forcieren und die rußländische Flotte, die in Sevastopol stationiert ist, nicht anzurühren –, oder sie hätte eine empfindliche Anhebung der Gaspreise verkraften müssen. Kyïv wählte die Politik der Zugeständnisse. Es nahm Verhandlungen über einen Beitritt der Ukraine zum Einheitlichen Wirtschaftsraum unter der Leitung Rußlands auf. Zukünftig werden alle postsowjetischen Staaten jedoch nach anderen Bezugsquellen für Energie suchen. Deshalb hat diese neue Integration um Rußland, die nur auf Energieressourcen beruht, langfristig keine Perspektive. Einige Staaten suchen den „Schutz“ Rußlands aus anderen Gründen. Bezeichnend ist das Beispiel des uzbekischen Staatschefs Islam Karimov, dessen Liebe zu Moskau entbrannte, als sein Regime ins Trudeln geriet. Zu Rußland kehren diejenigen Staaten zurück, deren Führer um ihre Macht fürchten. In der Spätphase der Sowjetunion hatte Rußland aufgehört, die Rolle des Gendarmen zu spielen. Aber in den letzten Jahren gab es sowohl in Rußland als auch außerhalb wieder Initiativen, die es zur Rückkehr zu dieser Rolle bewegen wollten. Zwei totalitäre Führer benötigen den Schutz Moskaus: Lukašėnka und Karimov. Moskau kann Lukašėnka nicht ausstehen und mißtraut Karimov. Aber es unterstützt beide aus einem einzigen Grund: um Belarus nicht in den Westen gehen zu lassen und Uzbekistan als Verbündeten zu halten. Je mehr Rußland die ins Wanken geratenen Regime unterstützt, desto stärker werden ironischerweise die antirußländischen Stimmungen in diesen Ländern. In der Mehrzahl der GUS-Länder steht ein Elitewechsel an. Die heutigen Eliten in den diktatorisch regierten Ländern, die von Angehörigen der sowjetischen Nomenklatura geführt werden, zählen auf die Unterstützung Rußlands. Aber die neuen Eliten werden zwangsläufig mit neuen Machtvektoren experimentieren und eine Partnerschaft mit China, Indien, Pakistan, Südkorea, Iran und vielleicht auch mit dem Westen suchen. Die Fixierung des Kremls auf die alten Machthaber ist kurzsichtig. Rußland und seine Konkurrenten im postsowjetischen Raum müssen noch etwas anderes erkennen: Die neuen Staaten haben die Taktik des Lavierens gewählt. Sie verfolgen eine Politik, die sie selbst als „distanzierte Partnerschaft“ bezeichnen und die es ihnen erlaubt, alle großen Akteure zu umwerben und daraus eigene Vorteile zu ziehen. Früher oder später werden Rußland, China und die USA sich damit auseinandersetzen müssen, daß die Staaten Zentralasiens, des Südkaukasus und des europäischen Teils damit angefangen haben, untereinander Vereinbarungen zu schließen und zu unabhängigen Kräften in diesen Regionen zu werden. Außerdem versuchen Staaten wie Kazachstan, Uzbekistan und die Ukraine schon heute, die Hegemonie in ihrer Region zu erlangen. Die Staaten, die sich am Westen orientieren, träumen von der Integration in die EU und die NATO. Die Krise der EU hat die europäische Integration zwar gebremst. Aber daran, daß die Ukraine, Moldova und Belarus in die europäischen Strukturen einbezogen werden, besteht kein Zweifel. Sogar das Rußland gegenüber loyale Armenien gibt dem Beitritt zur EU den Vorzug vor der GUS-Mitgliedschaft und baut enge Beziehungen zur NATO auf. Es ist nur eine Frage der Zeit, der Reihenfolge und der Art, wie diese Staaten in die westliche Einflußsphäre eingebunden werden. Für Rußland ist es wichtig, ob diese Anbindung über die NATO oder die EU erfolgt: Ersteres wird Moskau nur schwer verkraften, letzteres leichter, obwohl Rußlands Beziehungen zur NATO besser sind als zur EU. Hieraus abzuleiten, daß diese Staaten Rußland bereits nicht mehr brauchen, wäre falsch. All diese Staaten, sogar die drei baltischen Länder, sind an einer umfassenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Rußland interessiert. Für die meisten würde der Abbruch der Beziehungen zu Rußland eine wirtschaftliche Krise heraufbeschwören. Nehmen wir die Ukraine: Der Export der Produktion der ukrainischen Eisen- und Stahlindustrie in die EU brachte der Ukraine im Jahr 2005 2,5 Milliarden Dollar ein, und der Export nach Rußland 2,1 Milliarden Dollar. Europa kaufte Erzeugnisse des ukrainischen Maschinenbaus für 760 Millionen Dollar und Rußland für 2,2 Milliarden Dollar. Die ukrainische chemische Industrie steigerte ihren Export nach Rußland gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent, in die EU verminderte er sich um zwei Prozent. Andere Länder wie Armenien benötigen rußländische Investitionen und Energieträger. Georgien, Azerbajdžan, Moldova, Tadžikistan, Belarus und die Ukraine betrachten Rußland als einen Markt für ihre Arbeitskräfte und als Quelle, um das eigene Budget aufzustocken. Ihnen fließt aus Rußland Geld zu, das Millionen ihrer Bürger dort verdient haben. Für Staaten wie Kazachstan und Kyrgyzstan, ist die Zusammenarbeit mit Rußland auch eine Sicherheitsgarantie gegen China. Deshalb brauchen diese Staaten die Zusammenarbeit mit Rußland. Aber sie wollen nicht in völlige Abhängigkeit geraten. Rußland muß noch lernen, mit den Bestrebungen seiner Nachbarn vernünftiger umzugehen, die sich gleichzeitig in zwei Richtungen orientieren: auf Rußland und nach Westen. Für Rußland ist es viel vorteilhafter, wenn die Nachbarstaaten nicht zu seinem cordon sanitaire, sondern zu einer Brücke zwischen Rußland und dem Westen werden. Rußland hat objektive Gründe, seine Interessen im postsowjetischen Raum zu verfolgen. Aber es steht zu bezweifeln, daß Rußland in seinem heutigen Zustand als ein Faktor für Stabilität und Modernisierung Eurasiens wirken kann. Wenn es Rußland gelingt, sich zu transformieren, wird es zweifellos zu einem mächtigen Faktor für Fortschritt und zu einem attraktiven, nachahmungswerten Beispiel für seine Nachbarn werden. Wenn Rußland indes ein Land bleiben wird, das in der Übergangsperiode feststeckt, wird es die Transformation des postsowjetischen Raumes noch erschweren. Auf alle Fälle wird Rußland für alle diese Staaten der entscheidende Akteur bleiben. Rußland und Europa: zum Zusammenleben verdammt Das Verhältnis von Rußland und Europa hat zwei Dimensionen, eine internationale und eine zivilisatorische. Der Zusammenbruch des sozialistischen Weltsystems gab Rußland die Chance, sich geopolitisch und zivilisatorisch umzuorientieren, falls es sich „nach Europa“ bewegt: Nachdem Rußland aufgehört hatte, eine Großmacht in Europa zu sein, bekam es die Chance, zu einem europäischen Land zu werden“. Dies bedeutete „mehr Europa in Rußland“, d. h. Rußlands Umgestaltung nach europäischen Normen und Standards. Diese Europäisierung erwies sich jedoch als schwieriger als erwartet. Und die gemeinsamen wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Rußlands und Europas führten nicht automatisch zu gemeinsamen Werten. Während Boris El’cin vor allem auf Washington geschaut, Europa ignoriert oder die Europäer als bloße Handlanger der USA betrachtet hatte, zeigte Putin zunächst ein lebendiges Interesse daran, enge Beziehungen zur europäischen Staatengemeinschaft aufzubauen. Es gelang Rußland und der EU, sich auf vielen Feldern zu einigen: Dazu gehören die Einführung der Meistbegünstigungsklausel in den Handelsbeziehungen, Rußlands Anerkennung als Marktwirtschaft durch die EU, Brüssels Zustimmung zur WTO-Mitgliedschaft Rußlands, die Regelung des Kaliningrad-Problems sowie die schrittweise Übernahme der EU-Handelsregeln in die Handelsgesetzgebung Rußlands. Schließlich einigten sich Rußland und die EU auf „Vier gemeinsame Räume“ als Grundlage für die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, innere Sicherheit, äußere Sicherheit sowie kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Die Annäherung Rußlands und Europas stieß jedoch auf eine Reihe von Hindernissen, derer sich die beiden Seiten zunächst nicht bewußt waren. Anders als erwartet erwies sich die NATO für Moskau als der bequemere Partner als die EU. Anfangs traten Probleme auf, die mit den verschiedenen Entscheidungsprozessen in Moskau und Brüssel zu tun hatten. Die rußländische Diplomatie, die es nicht gewohnt war, konsensorientiert zu agieren, konnte überhaupt nicht verstehen, wie der schwergewichtige europäische Apparat funktioniert. Und sie konnte sich nicht daran gewöhnen, daß alle Entscheidungen der Abstimmung unter allen EU-Mitgliedern bedurften. Das Aufeinandertreffen der beiden Bürokratien – der vertikalen, auf Unterordnung ausgerichteten rußländischen und der stärker horizontalen, pluralistisch orientierten europäischen – konnte nur zu Mißverständnissen führen. Rußland forderte das Recht, am Entscheidungsprozeß der EU teilzunehmen, auch ohne Mitglied zu sein. Außerdem wollte Rußland einen besonderen Status in der europäischen Staatengemeinschaft erhalten. Moskau war unverständlich, daß ein solch mächtiger Staat wie Rußland die gleichen Rechte wie Polen oder Spanien haben solle. Obwohl Rußland den Entscheidungsprozeß in der EU beeinflussen wollte, war es natürlich nicht bereit, sich an die normativen Grundlagen der Union anzupassen. Die EU, die mit ihrer Erweiterung und deren Folgen beschäftigt war, hatte ihrerseits nicht die Zeit und die Kraft, eine tragfähige Strategie für Rußland zu entwickeln und ihre Positionen mit der rußländischen Seite in langwierigen Verhandlungen abzustimmen. Trotz aller regelmäßigen Treffen und Konsultationen zwischen Moskau und Brüssel wurde Ende 2003 klar, daß ihre „Partnerschaft“ einen rein deklarativen Charakter besitzt. Die Gründe für das Abkühlen der Beziehungen zwischen Rußland und der EU liegen nicht nur in den überzogenen Hoffnungen. Der Hauptgrund ist, daß Rußland und das vereinigte Europa zwei entgegengesetzte Entwicklungsmodelle darstellen. Das Ziel der EU ist es, die Nationalstaaten zu überwinden, die territorialen Grenzen aufzuheben und eine neue Gemeinschaft zu gründen, deren Politik auf Kompromissen beruht und in der die Meinung der Minderheit und einzelner Mitglieder berücksichtigt wird. Rußland hat sich im Gegensatz als „starker Staat“ organisiert und legt weiterhin großen Wert auf geopolitische Attribute wie das Territorium und die Souveränität, was jede Bewegung in Richtung auf eine Integration mit der EU a priori verhindert. Die Wertedifferenzen zwischen Moskau und Brüssel führten zu Verstimmungen. Die Kritik der EU-Staaten am Krieg in Tschetschenien und an der Einschränkung der Rechte und Freiheiten in der rußländischen Gesellschaft verstärkte die Gereiztheit des Kremls. Rußlands Mitgliedschaft im Europarat lief darauf hinaus, daß dessen Parlamentarischer Versammlung. Rußland kritisierte und Rußland immer hoffnungslosere Versuche unternahm, den eigenen Ruf zu verbessern. Doch trotz der unterschiedlichen Werte verbindet die EU und Rußland vieles. Das macht das Bild noch komplizierter: Da sind die geographische Nähe, die kulturellen Gemeinsamkeiten und die ökonomischen Interessen. Mehr als 48 Prozent seines Außenhandels wickelt Rußland mit der EU ab. Ein Drittel des Gasbedarfs der EU deckt Gazprom. Auf acht EU-Länder entfallen 74 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in Rußland – der Anteil der USA beträgt ungefähr 4,3 Prozent. Rußland exportiert in die erweiterte EU Waren im Wert von mehr als 104 Milliarden Dollar – in die USA beträgt der Wert rund sechs Milliarden Dollar. Der Warenimport aus den USA nach Rußland nimmt ab, 2006 hatte er einen Wert von rund zwei Milliarden Dollar; der Import Rußlands aus der EU aber wächst und hatte 2006 einen Wert von rund 32,6 Milliarden Dollar. Die gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen zwischen Rußland und der EU überlagern die Unvereinbarkeit ihrer Werte. Natürlich hängt die künftige Entwicklung davon ab, was sich als stärker erweist – die gemeinsamen Interessen oder die sich widersprechenden Werte. Bisher konnten der Handel und die guten bilateralen Beziehungen Moskaus mit einzelnen Hauptstädten wie Berlin, Paris und Rom die Widersprüche zwischen Moskau und Brüssel mildern. Doch die Wirtschaftsbeziehungen alleine können die strukturellen Widersprüche zwischen Rußland und der EU nicht auflösen. In den 1990er Jahren verfolgte die EU einen Kurs, der sich als „Transformation durch Integration“ bezeichnen läßt. Als dieser Kurs nicht zu den erwarteten Ergebnissen führte, begann die EU einer anderen Formel den Vorzug zu geben: „Integration durch Transformation“. Sie sah eine Annäherung Rußlands an die EU nur in dem Maße vor, wie Rußland sich reformiert und bereit ist, die Prinzipien der EU zu übernehmen. Einstweilen haben Rußland und die EU ihre Divergenzen akzeptiert, ohne damit eine künftige Annäherung endgültig auszuschließen: Sie imitieren eine Partnerschaft. Moskau hat es gelernt, Brüssel zu umgehen und seine Beziehungen bilateral zu knüpfen, vor allem mit Deutschland und Frankreich. Dies untergräbt Brüssels Bemühungen um eine gemeinsame Rußlandpolitik der EU: Rußland ist ein Meister darin geworden, die Komplexität der EU für seine eigenen Zwecke zu nutzen, indem es verschiedene Ebenen der Organisation gegeneinander ausspielt. Dies hat die Kohärenz der EU nicht gestärkt. Während Moskau mit dem „alten Europa“ pragmatische, wenn auch nicht mehr so herzliche Beziehungen unterhält, läuft im Verhältnis zum „neuen Europa“ nicht alles so glatt. Besonders allergisch reagiert Moskau auf Polen, das die Rolle eines Missionars im postsowjetischen Raum, besonders in der Ukraine und in Belarus, zu spielen versucht, was im Kreml auf Empörung stößt. Die rußländische Elite kann ihre Gefühle gegenüber Polen nicht unterdrücken, was die von Zeit zu Zeit – wie auf Kommando – in Rußland aufflammenden antipolnischen Stimmungen zeigen. Seine Unzufriedenheit mit der polnischen Politik bringt Moskau ziemlich offen zum Ausdruck – durch Handelssanktionen gegen polnische Waren oder durch den Versuch, Polen von den künftigen Energieadern „abzuschneiden“. In nächster Zeit sind von Brüssel, das von den eigenen Problemen absorbiert ist, kaum neue Initiativen zu erwarten. Aber die bloße Existenz des Projekts der europäischen Integration, das ehemalige sowjetische Satelliten einbeziehen will, und die einflußreiche europäische öffentliche Meinung, die darum besorgt ist, was in Eurasien vor sich geht, machen die EU zu einem wesentlichen Einflußfaktor in Rußland. Der Erfolg der europäischen Integration und des europäischen Gesellschaftsmodells könnten zu einem Vorbild für Rußland werden. Wenn die zahlreichen deckungsgleichen Interessen in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit sowie die kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen Europa und Rußland schon nicht tragfähig sind, um die Annäherung zu erleichtern, können sie doch die Enttäuschung mildern, die sich in den Beziehungen noch häufig einstellen wird. Rußland und die USA: eine schwierige Asymmetrie Die Beziehungen zwischen Rußland und den USA lassen sich kaum verstehen, ohne das zwiespältige Verhältnis der herrschenden rußländischen Klasse zu Amerika in Betracht zu ziehen. Einerseits betrachtet die rußländische Elite die Amerikaner als die einzige Nation, die der russischen dem Charakter und der Weltsicht nach nahesteht und die Rußlands Aufmerksamkeit verdient. Der rußländischen Elite imponiert Amerikas Messianismus und sein Hang zur Macht. Die Elite kopiert, mitunter vielleicht sogar unbewußt, den American way of life und das Verhalten der Amerikaner auf internationaler Bühne. Andererseits kann die rußländische Elite die Amerikaner gerade aus denselben Gründen nicht ausstehen, deretwegen sie die USA verehrt und bewundert. Rußland kann sich nicht erlauben, wie Amerika aufzutreten oder mit ihm in Machtkategorien zu konkurrieren, denn für eigene globale Ambitionen fehlen Rußland schlicht die Ressourcen. Rußlands politische Klasse vergleicht sich permanent mit Amerika und haßt Amerika sowohl für diesen unwillkürlichen Drang, sich zu vergleichen, als auch dafür, daß der Vergleich zumeist zu den eigenen Ungunsten ausfällt. Unfähig, die eigenen Gefühle zu beherrschen, versucht die rußländische Elite häufig, die Amerikaner zu ärgern, sogar wenn dies den eigenen Interessen schadet. Diese zwiespältigen Gefühle führen zu Stimmungsschwankungen, die das Verhältnis der rußländischen politischen Klasse zu Amerika beeinflussen, was die Amerikaner, die ein solches vom Unterbewußtsein beeinflußtes Verhalten nicht gewöhnt sind, zwar nicht schockiert, jedoch sicherlich befremdet. Die Tatsache, daß Amerika nach dem Zerfall der UdSSR der einzige Hegemon ist, löst bei Rußland keine positiven Gefühle aus. Seine Elite ist noch nicht über den Verlust der einstigen Macht hinweggekommen. Außerdem ist es Rußland nicht gewohnt, in einer unipolaren Welt zu leben. Das Bestreben der Amerikaner, die Welt davon zu überzeugen, daß sie eine „unentbehrliche Nation“ seien, löst unter der rußländischen Elite Widerwillen aus. Diese Elite hat die sowjetischen Zeiten vergessen, als sie sich nicht scheute, die Rolle der UdSSR genauso zu definieren. Die amerikanische Überheblichkeit empört die rußländische Elite nicht etwa deshalb, weil sie ein solches Verhalten anwidern würde – wie es die Europäer anwidert, welche die „Attitüde des Hegemons“ nicht ausstehen können –, sondern gerade deswegen, weil diese Elite sich diese Überheblichkeit selbst nicht leisten kann. Es ist nicht verwunderlich, daß die rußländische politische Klasse jede Artikulation amerikanischer Interessen, sogar wenn diese objektiv mit Rußlands Interessen übereinstimmen, als eine Non-Win-Situation betrachtet. „Wir benötigen keinen Sheriff“, sagen die rußländischen Politiker und meinen damit, daß Rußland selbst gerne einer wäre. Es entsteht die paradoxe Situation, daß die Kremlfunktionäre, während sie die Amerikaner kritisieren, ihnen zugleich Schritt für Schritt folgen, indem sie die Amerikaner kopieren: Die Amerikaner führen einen Krieg gegen den Terrorismus, und Rußland führt seinen eigenen Krieg gegen den Terrorismus. Die Amerikaner drohen Ländern, die sie nicht mögen, mit Präventivschlägen, und Moskau möchte dasselbe tun. Die Amerikaner fanden ihre „Achse des Bösen“ und der Kreml hat seine feindliche „Achse“. Wenn jemand anfängt, Moskau für seine Aggressivität gegenüber anderen Staaten zu kritisieren, antworten die Propagandisten des Kremls sofort: „Warum dürfen das die Amerikaner und wir nicht?“ Rußlands Politiker vergöttern den Maximalismus und betrachten jede Form von Konsens und Kompromiß als Zeichen von Schwäche, fast so wie es die amerikanischen Neokonservativen tun. Die krankhafte Aufmerksamkeit für Amerika und das Bestreben, die Welt durch das Prisma der Beziehungen zu den USA zu sehen, sind Ausdruck sowohl der unermeßlichen Ansprüche der rußländischen Elite als auch ihrer Unsicherheit, ihrer Komplexe und des Versuchs, dies durch Selbstsicherheit zu kaschieren. Diese Elite schmerzt vor allem eines: die mangelnde Aufmerksamkeit Washingtons gegenüber seinem alten Gegner. Diese Geringschätzung kann der Kreml Amerika nicht verzeihen. Die Beziehungen zwischen Rußland und den USA vollzogen unter Putin und Bush einige Wendungen. Ihre Präsidentschaft begann mit Mißtrauen. Aber im Juni 2001 auf dem Gipfel in Ljubljana fanden Bush und Putin unerwartet eine gemeinsame Sprache. Kurz danach folgte die Tragödie des 11. September 2001, die den Kreml zu einer ungewöhnlichen und unmißverständlichen Reaktion veranlaßte: Ohne zu zögern bot Putin Amerika seine Hilfe an. Mit seinem Anruf bei Bush direkt nach dem Terroranschlag verhielt sich Putin nicht nur wie ein prowestlicher Staatschef, sondern er schlug damit, wie es damals schien, auch eine neue Seite in den Beziehungen zu den USA auf. Die proamerikanische Wendung des rußländischen Staatschefs läßt sich auch dadurch erklären, daß der Terroranschlag auf Amerika in seinen Augen bestätigte, daß er Recht gehabt hatte, als er die Welt vor der Gefahr des internationalen Terrorismus gewarnt hatte. Damit schien auch die Begründung richtig, die er für den Krieg in Tschetschenien angeführt hatte, gegen den der Westen war. Aber Putin hätte auch eine vorsichtigere Haltung im Verhältnis zu den USA einnehmen können, besonders angesichts dessen, daß sein Umfeld die Unterstützung der Amerikaner kategorisch ablehnte. Aber er beschloß, daß der Zeitpunkt für eine rußländisch-amerikanische Partnerschaft gekommen sei. Im November 2001 flog Putin auf einen Gipfel nach Washington, genau zu dem Zeitpunkt, als Kabul fiel und die Taliban niedergekämpft waren. Der rußländische Staatschef strahlte Optimismus aus, als er erklärte: Wenn irgendjemand denkt, daß Rußland wieder zu einem Feind der USA werden könne, der versteht nicht, was auf der Welt vorgefallen ist und was in Rußland selbst geschehen ist. Im Mai 2002 verabschiedeten die USA und Rußland eine „Erklärung über die neuen strategischen Beziehungen“, in der beide Seiten ein gemeinsames Interesse an der Stabilität in Zentralasien und im Südkaukasus bekundeten. Diese Erklärung bildete die Grundlage für die gemeinsamen Anstrengungen Rußlands und Amerikas bei der Sicherung der Stabilität im postsowjetischen Raum. Daß Moskau der Anwesenheit der Amerikaner in dieser Einflußsphäre zugestimmt hatte, war Ausdruck eines Stimmungsumschwungs in der rußländischen Führung. Aber das war das Crescendo in den rußländisch-amerikanischen Beziehungen. Kurz danach kühlten sie wieder ab. Washington bemerkte den Trendwechsel nicht sofort. Deshalb war Moskaus Weigerung, die Kampfhandlungen im Irak zu unterstützen, für das Weiße Haus eine Überraschung. Bald begannen sich die Anzeichen zu mehren, daß die Beziehungen zwischen Rußland und den USA keineswegs ungetrübt waren. Putin hatte offenbar gehofft, daß das Aufkommen der für die USA und Rußland gemeinsamen Bedrohung durch den Terrorismus es erlauben würde, ihre Partnerschaft zur politischen Priorität beider Staaten zu machen. Es könnte sein, daß Putin in dieser Zeit von einem globalen rußländisch-amerikanischen Kondominium träumte. Sehr bald zeigte sich jedoch, daß es für diese Hoffnungen keinen Anlaß gab. Die USA verstanden den Kampf gegen den Terrorismus auf ihre Weise. Und sie dachten nicht daran, Rußland zu ihrem wichtigsten Partner zu machen. Den Amerikanern war immer bewußt, was Amerika und Rußland trennte. Sie verfolgten ihre Interessen, ohne auf Moskau zu achten. Ebenso schenkten sie ihren atlantischen Verbündeten besondere Aufmerksamkeit. Sehr bald trat ein, was eintreten mußte. Die drei rußländisch-amerikanischen Themen, über die in Putins erster Amtszeit viel geredet worden war – der gemeinsame Kampf gegen den internationalen Terrorismus, die Partnerschaft bei der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und der Energiedialog –, blieben in der Schwebe. Es zeigte sich, daß die Partner verschiedener Meinung darüber waren, mit welcher Substanz diese Themen zu füllen waren. In Putins zweiter Amtszeit wurde unter den Angehörigen der rußländischen Elite die Idee von der „Großmacht Rußland“ wieder hoffähig. Die Logik des politischen Systems erforderte, daß der Kreml ein stärkeres außenpolitisches Selbstbewußtsein an den Tag legt. Sogar loyale Putin-Anhänger fingen an, über Putins „Versöhnlerei“ mit den Amerikanern zu murren. Als Kritikpunkte an den Amerikanern brandmarkte die rußländische Elite das Festhalten am längst überholten Jackson-Vanik-Amendment, den einseitigen Ausstieg aus dem ABM-Vertrag, die NATO-Erweiterung, den mangelnden Wille, den Rußlands Beitritt zur WTO zu unterstützen. Kritisiert wurde ebenfalls, daß auf Rußlands Aufgabe der Militärbasen in Vietnam und auf Kuba entsprechende Gesten der USA ausbleiben, die USA nach dem Ende der Kriegshandlungen in Afghanistan nicht bereit waren, sich aus Zentralasien zurückzuziehen und sich im postsowjetischen Raum einmischten. Während seiner zweiten Amtszeit änderte Putin nach und nach sein Verhältnis zu den USA. Statt der gewohnten Zurückhaltung erlaubte er sich nun kritische Äußerungen in Richtung Washington. Einmal sprach er von „Onkeln in Tropenhelmen“ , die meinen, alle belehren zu müssen. Ein anderes Mal sprach er von einem „Wolf, der weiß, wen er fressen muß.“ Damit meinte er natürlich Washington. Diese antiamerikanischen Töne zeugen davon, wie sich die Haltung des Kremls geändert hat. Rußlands herrschende Klasse betrachtet Amerika nicht länger als natürlichen Verbündeten. Präsident Bush hingegen verzichtete darauf, seinen „Freund“ Vladimir zu kritisieren. Ziemlich lange übten die USA mit Putins Autoritarismus Nachsicht, den sie für notwendig erachteten, um schmerzhafte Reformen durchzuführen. Gleichwohl wuchs in den USA die Sorge über die Entwicklung in Rußland wuchs. Der Fall Jukos wurde als Schlag des Kremls gegen das Privateigentum betrachtet, Moskaus Einmischung in der Ukraine und das Bestreben, die USA aus Zentralasien zu drängen, die Unterstützung autoritärer Regime wie des belarussischen unter Lukašėnka sowie die Verabschiedung des NGO-Gesetzes stießen auf Kritik. In all dem kam zum Ausdruck, wie sehr der Kreml all jene Prinzipien geringschätzte, auf denen Amerikas Innen- und Außenpolitik beruht. Washington hatte solange die Augen vor den Verstößen gegen demokratische Prinzipien in Rußland verschließen können, als es vermeintlich „gemeinsame Interessen“ gab. Doch je deutlicher zu erkennen war, daß Moskau von diesen Interessen ein anderes Verständnis an den Tag legte und den Versuch startete, seinen Einfluß im postsowjetischen Raum wiederherzustellen, desto stärker sahen die USA dies als ein Rückfall in Imperialismus und sowjetische Praktiken. Washington verbarg nun nicht länger seinen Ärger über Moskau. Die USA monierten nicht nur die Weigerung, die Militäroperation im Irak zu unterstützen, sondern auch den mangelnden Wille, dem amerikanischen Iran-Szenario zu folgen, die Unterstützung von Amerika feindlich gesinnten Regimen wie Libyen, Syrien, Iran und Venezuela, Rußlands Rüstungsexport in diese Staaten sowie nach China, den Dialog mit der Hamas, Sanktionen gegen Georgien und schließlich die Beschränkungen der Demokratie in Rußland. Es gibt somit strukturelle Hindernisse, die der „strategischen Partnerschaft“, die Putin und Bush verkündet hatten, im Wege stehen: Neben den erwähnten Diskrepanzen im politischen Grundverständnis reagiert Moskau immer empfindlicher auf die asymmetrische Ressourcenverfügung. Anders als mit der EU gibt es in den Beziehungen zwischen den USA und Rußland keine gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen. Auf die USA entfallen rund 2,6 Prozent des rußländischen Exports (Platz 11) und 4,6 Prozent des rußländischen Imports (Platz 5). Selbst über die Idee der Partnerschaft herrscht kein Konsens: Bush sieht in ihr neben einem Instrument der amerikanischen Sicherheitsagenda offenbar ein Mittel, um „rußländischen Expansionismus“ zu begrenzen, Putin dagegen einen Impuls, um Rußlands Rolle zu stärken. Washington betrachtet Rußlands Instrumentalisierung der Energieressourcen zu politischen Zwecken als eine Verletzung der Prinzipien der globalen Energiesicherheit. Rußland dagegen faßt das Hegemonialstreben der USA als Einschränkung der eigenen Souveränität auf. Moskau nimmt die Bestrebungen der USA, im postsowjetischen Raum Präsenz zu zeigen, als eine gegenüber Rußland unfreundliche Politik wahr. Die Orangene Revolution, die Moskau als Werk der USA betrachtet und die Wahrnehmung, daß die USA nicht vorhaben, sich aus dem Raum der GUS zurückzuziehen, scheint von Putin als Verrat aufgefaßt worden zu sein. Dem Ex-Oberstleutnant des KGB, der gerlernt hat, in Stereotypen der „Verteidigung“ zu denken, scheint der Gedanke durch den Kopf geschossen: „Wir sind umzingelt!“ Den letzten Stoß versetzte dem Vertrauen des Kremls der Verdacht, das Weiße Haus betrachte die Demokratie nur als ein Mittel, den rußländischen Staat von innen auszuhöhlen. Das Fazit liegt auf der Hand. Am Ende der Regierungszeit von Bush und Putin herrschen auf beiden Seiten keine Illusionen mehr über den tatsächlichen Gehalt ihrer Beziehungen. Die näherrückenden Präsidentschaftswahlen in beiden Ländern, in deren Vorfeld sicherlich die „rußländische Karte“ und die „amerikanische Karte“ gespielt werden wird, dürften wohl kaum zu besseren Beziehungen zwischen Amerika und Rußland führen. Bei den vorletzten Präsidentschaftswahlen versäumten es die Republikaner nicht, Clinton und den Demokraten vorzuwerfen, sie hätten Rußland „verloren“. Dieses Mal ist ein ähnliches Manöver von den Demokraten zu erwarten. In Rußland ist der Antiamerikanismus zum Kriterium für den Patriotismus der rußländischen Elite geworden. Sie werden ihn im kommenden Wahlmarathon sicherlich besonders offensiv zur Schau stellen wird. Der Sieg der Demokraten bei den amerikanischen Zwischenwahlen im Herbst 2006 hat in Moskau Besorgnis ausgelöst. In Rußland herrscht die Überzeugung, daß die Beziehungen zu einer Administration unter den Demokraten schwieriger sind als zu einer unter den Republikanern. Rußlands außenpolitisches Establishment hat vergessen, daß Rußland unter Clinton herzliche Beziehungen zu den USA pflegte, während sich das Verhältnis zu Amerika während Reagans Regierungszeit nach dem Drehbuch des „Kalten Krieges“ entwickelte. Selbst Bush versteht jedoch, daß er es sich – ungeachtet aller Probleme – nicht erlauben kann, die Spannungen mit Moskau eskalieren zu lassen. Das ist verständlich: Washington muß das Iran-Problem regeln und versuchen, Putins Spiel mit den Energieressourcen zu hegen. Außerdem muß er vermeiden, daß jede Härte des Weißen Hauses gegenüber Rußland als Eingeständnis interpretiert werden könnte, daß die Partnerschaftspolitik gescheitert sei. All diese Überlegungen zwingen die USA, den Dialog mit Moskau fortzusetzen. Deshalb reiste Bush im Sommer 2006 nach Petersburg, um am G8-Gipfel teilzunehmen. Und im Herbst 2006 gab Bush „grünes Licht“ für den WTO-Beitritt Rußlands. Zugleich verliert der Präsident aber die Initiative in der Rußlandpolitik. Die USA sind in eine Lage geraten, in der jeder beliebige Kurs im Verhältnis zu Rußland zum Scheitern verurteilt ist. Es kann kein gegenseitiges Verständnis entstehen, solange in Rußland keine Veränderungen stattfinden. Rußland zu isolieren wäre gefährlich, denn Washington braucht Moskau, um eine Reihe von Problemen zu lösen, welche die Interessen der USA berühren. Rußland zu marginalisieren ist ebenfalls keine Variante, denn sie würde die Unvorhersagbarkeit dieses Landes nur noch erhöhen. Der Versuch, auf den Kreml Druck auszuüben, ist zwecklos: Die rußländische Seite hat nicht vor, Ratschläge zu befolgen, da dies in den Augen der rußländischen Öffentlichkeit ein Zeichen von Schwäche wäre. Außerdem haben die Amerikaner praktisch keine Druckmittel gegen den Kreml in der Hand. Gegenüber der rußländischen Macht nachsichtig zu sein, würde einer Ermunterung für die Aktivitäten eines Staates gleichkommen, der Amerika seinen Werten nach fremd ist. Was den Kreml betrifft, so engt die Tatsache, daß Moskau die USA als Feindbild für seine innenpolitischen Zwecke benutzt, den Spielraum für einen konstruktiven Dialog mit Washington ein. Sogar eine Annäherung von Moskau und Washington in den Fällen Iran und Nordkorea wird diesen unerfreulichen Rahmen der Beziehungen kaum ändern können. Am Ende der Präsidentschaften von Bush und Putin werden sich die Beziehungen zwischen den USA und Rußland nicht mehr ändern. Die abtretenden Staatschefs haben weder Zeit noch die Chance, neue Impuls zu geben. Bush ist gezwungen, sich auf den Irak zu konzentrieren, was zum Hauptmotiv der amerikanischen Politik geworden ist. Rußland ist für die USA zur Peripherie geworden, die das Kräfteverhältnis nicht wesentlich beeinflussen kann. Putin hat bereits seinen Eifer und sein Interesse an der Außenpolitik verloren. Zwar können die USA in der rußländischen Politik und Rußlands Verhältnis zu Amerika zu einem Thema des politischen Kampfes werden, um die Wählerschaft zu mobilisieren, aber nur indem Amerika dämonisiert wird. Bis neue Präsidenten gewählt sein werden, ist das Maximum, was die amtierenden Administrationen erreichen können, neue Konflikt zu verhindern und den Dialog aufrechtzuerhalten. Die Nachfolger, die 2008 und 2009 in den Kreml und das Weiße Haus einziehen werden, treten ein schweres Erbe an. Sie müssen neu darüber nachdenken, welche Bedeutung Rußland und Amerika füreinander haben. Danach werden sie das Problem der Energiesicherheit und die Implikationen der Politisierung dieses Politikfeldes zu durchdenken haben. Auf der Tagesordnung wird dann auch stehen, den Dialog über die Atomwaffen wieder aufzunehmen. Neben den Themen, die beide Seiten in- und auswendig können – die Zusammenarbeit bei der Raumfahrt und die friedliche Nutzung der Atomenergie – könnten auch die Probleme in Eurasien zum Gegenstand der rußländisch-amerikanischen Gespräche werden. So könnten die Konfliktherde Transnistrien und im Südkaukasus beseitigt und die Stabilität in Zentralasien erreicht werden. Aber es wäre naiv zu glauben, daß die neuen Staatschefs allein auf der Grundlage gemeinsamer Interessen stabilere Beziehungen schaffen werden. Partielle Übereinstimmung führt nicht automatisch zu einer stabilen Partnerschaft. Die Wertedifferenzen zwischen Rußland und Amerika führen zu unterschiedlichen Bewertungen vermeintlich deckungsgleicher Interessen. Exemplarisch sei das Verhältnis zum internationalen Terrorismus genannt. Washington und Moskau sind nicht einer Meinung, wer als terroristische Organisation anzusehen ist. Amerika hält die Hamas und die Hisbollah für terroristische Organisationen, Moskau nicht. Insofern ist die Zahl der Themen, die sie gemeinsam erörtern, kein Hinweis darauf, daß die Partnerschaft zwischen Rußland und den USA effektiv und stabil ist. Im Gegenteil: Wenn die gemeinsame Weltsicht fehlt, kann der Dialog die gegenseitigen Enttäuschungen und Vorurteile noch verstärken. Vielleicht ist jedoch die Suche nach Möglichkeiten der weiteren Einbindung, unabhängig von den Erfolgsaussichten nach dem Motto des „Dialogs um des Dialogs willen“, die einzige Chance, das weitere Auseinanderdriften von Amerika und Rußland zu verhindern. Die zentrale Basis für eine stabile Partnerschaft ist die Abkehr der USA vom militärgestützten Hegemonialstreben und der Übergang Rußlands zu demokratischen Standards. Aus dem Russischen von Corina Alt, Berlin
Volltext als Datei (PDF, 146 kB)