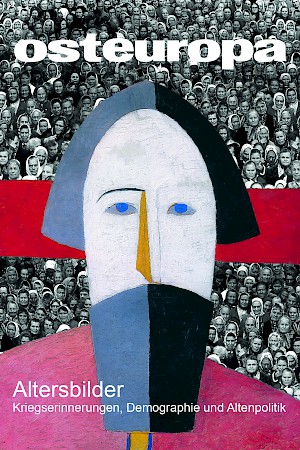Wenn Stumme mit Tauben reden
Generationendialog und Geschichtspolitik in Russland
Volltext als Datei (PDF, 120 kB)
Abstract in English
Abstract
Der 65. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg im Mai 2010 ist der letzte, den eine nennenswerte Zahl von Kriegsteilnehmern noch erlebt. Vor zehn Jahren stand dem Mythos vom glänzenden Sieg noch die lebendige Erinnerung von Millionen Kriegsteilnehmern entgegen. Heute ist die Weitergabe eigener Erinnerung praktisch versiegt. Junge Menschen sind in Russland einer ideologisierten, pseudopatriotischen Erinnerungspolitik ausgeliefert. An sich wäre das Familiengedächtnis eine Quelle der Erinnerung. Doch selbst das war immer fragmentiert und widersprüchlich. Traumata und Zensur verhinderten, dass die Alten sich öffneten. Die umstürzende Dynamik der 1990er Jahre führte dazu, dass den Jungen die Werte und Erfahrung der Alten nichts mehr galten. Ein Zwiegespräch über historische Erfahrungen kam so kaum zustande.
(Osteuropa 5/2010, S. 17–26)
Volltext
Der 65. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg im Mai 2010 ist der letzte, den eine nennenswerte Zahl von Kriegsteilnehmern noch erlebt. Vor zehn Jahren stand dem Mythos vom glänzenden Sieg noch die lebendige Erinnerung von Millionen Kriegsteilnehmern entgegen. Heute ist die Weitergabe eigener Erinnerung praktisch versiegt. Junge Menschen sind in Russland einer ideologisierten, pseudopatriotischen Erinnerungspolitik ausgeliefert. An sich wäre das Familiengedächtnis eine Quelle der Erinnerung. Doch selbst das war immer fragmentiert und widersprüchlich. Traumata und Zensur verhinderten, dass die Alten sich öffneten. Die umstürzende Dynamik der 1990er Jahre führte dazu, dass den Jungen die Werte und Erfahrung der Alten nichts mehr galten. Ein Zwiegespräch über historische Erfahrungen kam so kaum zustande. Ein zentrales Thema des 19. Jahrhunderts war in Russland die Beziehung zwischen „Vätern und Söhnen“. Heute scheinen die intergenerationellen Beziehungen kaum jemanden zu interessieren. Dies ist umso auffälliger, als heute jedermann von Erinnerung und kollektivem Gedächtnis spricht, von Themen, denen ein Generationskonflikt geradezu inhärent ist. Natürlich wird trotzdem darüber diskutiert, welche Werte, Vorstellungen und Leitbilder die heutige Jugend hat. Über Fragen also, die gerade auch die Alten interessieren. Vor kurzem gab es etwa stürmische Diskussionen über die extreme Darstellung der Lebensweise von Oberschülern in der TV-Serie Škola von Valerija Gaj-Germanika. Pavel Bardins umstrittener Film über junge Rechtsextreme Rossija 88 gelangte gar nicht erst in die großen Kinos. Als Gegengewicht zu den „bösen“ jungen Leuten – nicht nur den Filmfiguren, sondern auch zu den Regisseuren – sehen sich die Aktivisten der kremltreuen Gruppe Naši (Die Unsrigen) das „patriotische“ Thema des Zweiten Weltkriegs an. Sie gebärden sich als Beschützer von Veteranen, die nicht nur von Beamten diskriminiert würden, sondern auch von Bürgerrechtlern, die das Bild vom Zweiten Weltkrieg kritisieren, das offizielle Veteranenorganisationen der Gesellschaft vorschreiben möchten. So halten die Naši etwa eine „lebenslängliche Mahnwache“ vor dem Haus des Journalisten und Bürgerrechtlers Aleksandr Podrabinek ab. Podrabinek hatte in einem scharfen Artikel die Forderung von organisierte Veteranen kritisiert, der Antisovetskaja Šašlyčnaja (Antisowjetischen Schaschlik-Bude) diesen angeblich ehrverletzenden Namen zu verbieten. Die Naši demonstrieren auch vor der estnischen Botschaft gegen die Verlegung des sowjetischen Soldatendenkmals in Tallinn oder weisen auf ihrer Homepage an prominenter Stelle auf eine Internetseite hin, auf der ein „Goebbels-Preis“ an Historiker, Journalisten und Bürgerrechtler verliehen wird, die den Zweiten Weltkrieg abweichend von der offiziellen, sowjetischen Lesart darstellen. Zu diesem Geschichtsbild gehört heute ganz offen – ohne den verschämten Gestus der Brežnev-Zeit – auch Generalissimus Stalin als derjenige, dem der Sieg zu verdanken ist. Da der Stolz auf die Großmacht Russland das konstitutive Element dieses Geschichtsbildes ist, darf der lange, schreckliche Krieg, der das Land zur Gänze entkräftet und ausgezehrt hat, in ihm nicht vorkommen. Stattdessen wird der Sieg im Krieg inszeniert, auf dem die Vorstellung von der einstigen, heutigen und künftigen Größe Russlands gründet: "Um die Aussichten auf eine künftige Vorherrschaft Russlands einzuschätzen, nehmen wir Russland als historisches und geographisches Zentrum der heutigen Welt in den Blick. Bereits das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert Russlands. Dreimal hat Russland in diesem Jahrhundert die Richtung der Weltgeschichte bestimmt. Die Oktoberrevolution war eine historische Explosion, ihre Folgen dominierten die weltpolitische Tagesordnung des 20. Jahrhunderts. Russlands Sieg im Großen Vaterländischen Krieg legte das Fundament für die Weltordnung in der zweiten Jahrhunderthälfte. Russlands Abkehr vom kommunistischen System gab den Anstoß zur neuen Weltordnung des 21. Jahrhunderts. Ohne eine adäquate Einschätzung dieser drei Ereignisse können Russlands Perspektiven in der gegenwärtigen Welt nicht bestimmt werden […] Russlands Sieg im Großen Vaterländischen Krieg schuf das Fundament für eine Weltordnung, die die Welt bis vor kurzem vor der Hegemonie eines einzigen Landes (sei es Nazideutschland oder die USA) und vor einem dritten Weltkrieg bewahrte. Ferner gab der Sieg den Anstoß zum Zusammenbruch der Kolonialmächte und zur Befreiung Dutzender von Ländern und Völkern. Das Recht eines jeden Volkes auf freie Entwicklung ist Resultat von Russlands Sieg über den Faschismus." STALIN ALS EINHEITSSTIFTENDES SYMBOL Wenn der Krieg also wie im Manifest von Naši nur als Sieg betrachtet wird, der den Völkern Frieden gebracht hat, verbietet das jedes Nachdenken über den Preis des Sieges und jeden Versuch, noch unbekannte Aspekte der Kriegsgeschichte aufzuarbeiten. Vor allem aber blockiert dieses Geschichtsbild die öffentliche Weitergabe von authentischen Kriegserinnerungen an die junge Generation. Stattdessen finden stürmische Debatten über die Ehrung der Veteranen statt, zu deren Zwecke angeblich zum 65. Jahrestag des Sieges – dem letzten, den eine nennenswerte Zahl von Kriegsteilnehmern aller Wahrscheinlichkeit nach noch erleben kann – in vielen Städten Russlands Stalin-Porträts aufgehängt werden müssten. Das Beispiel zeigt deutlich, wie junge Menschen in Russland heute der verzerrten offiziellen Veteranenerinnerung, vor allem aber einer ideologisierten, pseudopatriotischen Erinnerungspolitik ausgeliefert sind. Diese Politik trägt in erster Linie dazu bei, die Erinnerung an die Repressionen zu verdrängen, über die man Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre endlich zu reden begonnen hatte. In Umfragen der vergangenen Jahre nannten die meisten Menschen als wichtigstes Ereignis in der Geschichte Russlands im 20. Jahrhunderts, den Großen Vaterländischen Krieg, danach folgt – mit großem Abstand – Gagarins Flug ins All. Nach Stalins Rolle in der Geschichte Russlands gefragt, assoziierten ihn mehr als 40 Prozent mit dem Sieg im Krieg und nur zehn Prozent mit Terror und Repressionen. Aus der Erinnerung an den Krieg fällt also all das heraus, was nicht zum Mythos des Sieges passt: der große Terror von 1937/38, der kurz vor Kriegsausbruch auch die Offizierselite der Roten Armee dezimierte; Stalins schwere Fehlentscheidungen zu Kriegsbeginn und die brutalen Methoden der Kriegführung, die Millionen von Soldaten das Leben kosteten; die Deportation ganzer Völker, die der Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht beschuldigt wurden; die grausame Behandlung von den aus deutscher Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Soldaten und ehemaligen Zwangsarbeitern; die blutige Niederschlagung von Befreiungsbewegungen im Osteuropa der Nachkriegszeit und vieles mehr. Dass die Folgen des Hitler-Stalin-Pakts in den baltischen Staaten, Polen und der Westukraine aus der ideologisierten Erinnerung ausgeklammert sind, versteht sich von selbst. Auch der Holocaust passt nicht zum Siegesmythos und wurde deshalb aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt, wobei sich sein Verschweigen im Laufe der Jahrzehnte, bis zur Perestrojka, zu einem zusätzlichen Trauma entwickelte. Ferner wird der Verteidigungskrieg der Sowjetunion isoliert vom Zweiten Weltkrieg insgesamt betrachtet, die Rolle der Alliierten herabgesetzt, und mit der Figur Stalin erlebt auch der Antagonismus des Kalten Krieges eine Renaissance. Dazu passt der Sturm der Entrüstung, der sich in der sogenannten patriotischen Presse und im rechtsextremen Internet erhob, als der Kreml begann, über eine gemeinsame Siegesparade mit den Alliierten nachzudenken. ABSCHIED VON DEN ZEITZEUGEN Vor zehn Jahren stand dem Mythos vom glänzenden Sieg im Krieg noch die lebendige Erinnerung von Kriegsteilnehmern gegenüber. Heute leben nur noch wenige Zeitzeugen – die Urgroßväter und Urgroßmütter der heutigen jungen Generation. Als Memorial zum 60. Jahrestag des Kriegsendes im Jahr 2005 einen Geschichtswettbewerb für Schüler zum Thema „Der Preis des Sieges“ ausschrieb, war eine typische Reaktion der befragten Zeitzeugen: „Warum seid ihr nicht schon früher gekommen? Jetzt kann ich ruhig sterben, nachdem ich alles erzählt habe, was mir keine Ruhe gelassen hat.“ Viele konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, weil sich zum ersten Mal jemand an sie wendete, um mit ihnen über dieses Thema zu sprechen. So etwas kann man heute kaum noch erleben. Im Jahr 1942 wurden die Männer des Jahrgangs 1924 einberufen, im letzten Kriegsjahr die des Jahrgangs 1927. Wer überlebt hat, ist heute weit über 80 Jahre alt. Die meisten Zeitzeugen sind in den letzten Jahren gestorben, die Menschen, die eigene Erinnerungen an die Front hatten und an die man daher hätte appellieren können, sich zu erinnern, sind tot. Die Weitergabe eigener Erinnerungen ist damit praktisch versiegt. Was als Quelle der Erinnerung bleibt, ist das Familiengedächtnis. In Russland reicht es allerdings meistens nicht weit zurück und ist, insbesondere wenn es um die Repressionen geht, aber auch bei den Kriegserinnerungen, bruchstückhaft. Außerdem führt auch die Erinnerung von Zeitzeugen nicht zum Verständnis von Ursachen, Folgen und Zusammenhängen. Und die Erinnerung muss keineswegs immer zur Wiederherstellung der historischen Wahrheit oder zu einem vertieften, komplexen Bild der Vergangenheit beitragen. Vielmehr ist diese Erinnerung oft sogar gerade eine Quelle der Sowjetmythologie („Mein Großvater hat gesagt, dass unter Stalin alles gut war, dass wir ohne Stalin den Krieg nicht gewonnen hätten, dass sie Stalins Namen riefen, wenn sie angriffen“). Kriegserinnerungen werden heute kaum noch unmittelbar, sondern häufig durch das Prisma der Brežnev-Zeit weitergegeben. Dies verschiebt den Blickwinkel erheblich und erklärt die Deformationen, auf die wir bisweilen im Bewusstsein vor allem junger Menschen stoßen. In den 1970er Jahren wurde das Klischeebild des Krieges geformt, das bis heute in den Medien, vor allem im Fernsehen lebendig ist: das gute Leben im Frieden, plötzlich der heimtückische Überfall des Feindes, dann die prächtigen Jünglinge und Mädchen, die nicht umkommen, sondern „ihr Leben opfern“. Dieses romantisierende Kriegsbild, das sich durch viele Filme, Romane und durch die Memoirenliteratur zieht, dient bis heute dazu, Erlebtes zu verdrängen und unbewältigte Traumata zu verhüllen. Aber die Erinnerung wurde nicht nur durch Filme und Bücher verzerrt. Nur wenigen Kriegsteilnehmern ist es gelungen, die Folgen ihrer traumatischen Erlebnisse zu überwinden und ihre Erfahrung auch nur ansatzweise zu reflektieren. Die meisten Frontsoldaten mussten – ebenso wie die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen – ihre verdrängten Traumata irgendwie ertragen. Viele begannen zu trinken, zerbrachen oder gingen auf andere Weise an den seelischen Verwundungen zugrunde. Die Kriegsgeneration wurde vor 70 Jahren zum Verstummen gebracht, und sie hat bis heute nicht wirklich zu reden begonnen, wenigstens nicht mit ihren Familienangehörigen. Die Menschen konnten ihre Traumata nicht erzählen, schreckliche Erlebnisse – eigene Grausamkeit oder erlittene Gewalt – nicht einmal sich selbst eingestehen und nahmen deshalb Zuflucht zu der abgegriffenen Formel „Der Krieg nimmt’s auf sein Konto“. Doch nicht alle Erlebnisse konnte man „abschreiben“. Ehemalige Frontkämpfer hatten große Mühe, sich ins zivile Leben einzufinden, empfanden Kompromisse als Lügen oder Ungerechtigkeit, hatten im Büro ihrer Vorgesetzten mehr Angst als zuvor an vorderster Front: „Mutig nahmen sie fremde Hauptstädte ein, voller Angst kehrten sie in die eigene zurück.“ Selbstverständlich wirkte sich das später auf ihre Familien, auf die Beziehungen zu ihren Frauen und Kindern aus. So hatte die traumatisierte Erinnerung Folgen auch für die nächsten Generationen. Und viele Kriegsteilnehmer nutzten seit den 1970er Jahren die Chance, sich hinter der vorgefertigten offiziellen Erinnerung mit dem ehrenvollen Veteranenstatus zu verschanzen. Die Mauer des Schweigens konnte erst Ende der 1980er oder Anfang der 1990er Jahre durchbrochen werden. Doch in den allermeisten russischen Familien lebten damals schon keine Zeitzeugen mehr, und die Rekonstruktion der Erinnerung an Krieg und Repressionen verlangte besondere Anstrengungen, an denen sich selten junge Menschen beteiligten. In einer derart gespaltenen Gesellschaft wie der russländischen musste Erinnerung, selbst innerhalb einer Familie, fragmentarisch und widersprüchlich sein, und ohne einen gemeinsamen sozialen und historischen Kontext konnten die Fragmente kein ganzes Bild ergeben – weder in der Vorstellung von Vertretern der älteren Generation und umso weniger in den Köpfen junger Menschen. Deshalb stiftete das geschönte Bild vom Sieg im Krieg einen scheinbaren Konsens, den die Erinnerung an die Repressionen nicht geben konnte. SCHWIERIGER DIALOG Damit ein Zwiegespräch über historische Erfahrungen entstehen kann, muss eine Seite bereit sein zu reden, die andere, Fragen zu stellen und zuzuhören. Diese Bereitschaft gab es in der sowjetischen Geschichte nur für sehr kurze Zeit: während des Tauwetters und in der Perestrojka. Allerdings wurde die Erinnerung an die dunklen Seiten des Krieges und an die Repressionen häufig nicht vertikal, sondern horizontal weitergegeben: Statt den Kindern von der Vergangenheit zu erzählen, erzählte man seinen Zeitgenossen, die ohnehin vieles ahnten. Die Gesellschaft benötigte die historische Erfahrung, um die Vergangenheit zu bewerten und Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, doch das Gespräch über die Vergangenheit verstummte rasch oder wurde Anfang der 1960er Jahre aufgrund der politischen Entwicklung und Anfang der 1990er aufgrund der ökonomischen Entwicklung gewaltsam unterbrochen. Für den Dialog – oder auch bloß für die Weitergabe historischer Erfahrung – ist auch eine gemeinsame Sprache vonnöten. Selbst Provokationen müssen erst einmal verstanden werden. Gemeint ist nicht nur der Wortschatz –, Jugendjargon gab und gibt es immer –, sondern auch über die Wertvorstellungen muss man sich verständigen können. Anfang der 1990er Jahre gab es in diesem Zusammenhang widersprüchliche Tendenzen, die sich bis heute auf die Weitergabe historischer Erinnerung auswirken. Starkes Interesse an der Vergangenheit zeigten damals nicht die jungen Leute – die damals 15–20-Jährigen, die heute 35–40 Jahre alt sind –, sondern die 40–60-Jährigen. Als die heutigen jungen Erwachsenen Kinder und Teenager waren, ermüdete die Gesellschaft bereits und versank in Nostalgie: Die Zeitzeugen redeten davon, wie gut man in der Sowjetzeit gelebt habe – sie meinten natürlich die Brežnev-Ära – und wie schwer man es in diesen chaotischen Zeiten habe. So sind auch die Alten daran schuld, dass heute gerade jene Jahre extrem negativ bewertet werden, in denen die Suche nach der historischen Wahrheit am intensivsten war. Gleichzeitig büßten in den 1990er Jahren alte Menschen viel Ansehen ein. Nur sehr wenigen gelang es, in der sogenannten Marktwirtschaft Fuß zu fassen. Die Werte und Leistungen ihres ganzen sowjetischen Lebens galten den Jungen nichts mehr. Wer hätte in dieser Zeit ein Gespräch mit den Alten über die Vergangenheit suchen, mit Respekt auf die Lebensleistung dieser Menschen schauen oder zumindest Mitleid mit ihnen haben wollen? Dem hässlichen Sowjetalltag, in dem die Rentner und Veteranen nach wie vor dahinvegetierten, konnte die konsumorientierte Jugend nichts abgewinnen. Angesichts der Schwierigkeiten des Alltags, mit denen die junge Generation in den 1990er Jahren konfrontiert war, wollten die Jungen nichts von einer schweren Vergangenheit hören, die nicht ihre eigene war. Hinzu kamen der Krieg in Afghanistan in den 1980er Jahren sowie die beiden Tschetschenien-Kriege, während derer die (post)sowjetischen Massenmedien die Bevölkerung mit der Rhetorik des Großen Vaterländischen Krieges zu mobilisieren versuchten. Auch die Traumata dieser Kriege blieben unverarbeitet. So entwickelten einige junge Menschen in den 1990er Jahren eine pazifistische Einstellung und betrachteten den Krieg prinzipiell als abstraktes Übel. Der weitaus größere Teil aber war schlicht nicht bereit, sich auf Tragisches oder Schweres einzulassen. Ihr Motto „Lass mich in Frieden“ meint nicht zuletzt, dass sie nicht bereit sind, sich mit der unverarbeiteten harten und schmerzlichen Vergangenheit zu beschäftigen, mit der Zeit, als ihre Väter und Großväter keinen Frieden hatten. WAS BLEIBT? In einer Gesellschaft ohne lebende Zeitzeugen bleibt nur noch das kollektive Gedächtnis. Man sollte meinen, dass es über den Krieg genügend Dokumente und Kunstwerke gibt. In den Jahrzehnten nach dem Krieg schufen Autoren und Regisseure ungeachtet der Zensur ein Bild vom Krieg, das sich vom offiziellen deutlich unterschied. Man denke an die Romane von Viktor Nekrasov, Vasilij Grossman, Vasilij Bykov, Vjačeslav Kondrat’ev, Viktor Astaf’ev und Grigorij Baklanov oder an die Filme von Aleksej German oder Larisa Šepit’ko. In den letzten Jahren drehten Vertreter der jüngeren Generation wie Aleksej German junior oder Dmitrij Meschiev Spiel- und Dokumentarfilme, die schwierige Fragen aufwarfen und komplizierte Themen wie die Partisanenbewegung, das Leben unter der Besatzung, das Schicksal deutscher Kriegsgefangener behandelten und dabei eine neue Sprache entwickelten. Memoiren wurden veröffentlicht, die zuvor zensiert gewesen waren. Auch das Internet macht den Zugang zu Daten und Dokumenten grundsätzlich leichter. Tatsächlich werden Themen, die mit dem Krieg zusammenhängen, im Internet – das ja vor allem junge Leute nutzen – stürmisch diskutiert. Dennoch ist das Wissen über den Krieg dadurch nicht umfassender und präziser geworden. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: Das Bild, das sich Jugendliche vom Krieg machen, ist simpler geworden und gleichzeitig aufpoliert, es erinnert an Computerspiele oder Video-Clips. Zudem hat die Geschichtspolitik der letzten Jahre, die nicht auf die Bewahrung der Erinnerung zielt, sondern den Krieg zur ideologischen Grundlage eines neuen russischen Patriotismus macht, das Kriegsbild in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen verzerrt. Hinzu kommen neue Geschichtsbücher, in denen der Sieg zur Rechtfertigung der als „Modernisierung“ präsentierten Gewaltexzesse der 1930er Jahre verwendet wird. Auf diese Weise wird Stalin rehabilitiert und Gewalt als effektives politisches Steuerungsinstrument gerechtfertigt. Die Folgen sind offensichtlich. Sie zeigen sich exemplarisch in dem Geschichtswettbewerb, den Memorial seit 1999 an Schulen durchführt. Von den 2000–3000 Texten über die sowjetische Vergangenheit, die jährlich eingehen, behandelt etwa ein Drittel den Krieg. Die jugendlichen Autoren, viele von ihnen aus der Provinz, gehören bereits zu den Besten ihrer Klasse: Anders als viele ihrer Altersgenossen machen sie sich Gedanken über die historische Vergangenheit und nehmen die Mühe auf sich, eine Arbeit über die Geschichte ihrer Familie oder ihrer Region zu verfassen. Doch an diesen Texten lässt sich ablesen, wie die sowjetische Vergangenheit und speziell der Krieg verdrängt, verzerrt oder mythologisiert werden. In den ersten Jahren leiteten fast alle Schüler ihre Texte mit der Feststellung ein, dass Russland eine tragische, schwere Vergangenheit hat. Obwohl das manchmal etwas schematisch klang, hatte man doch den Eindruck, dass die Jugendlichen begriffen hatten, dass die sowjetische Vergangenheit hart und schrecklich gewesen war, umso mehr, als ihre Texte das in jeder Hinsicht bestätigten. Ungefähr seit 2004 hat sich dies geändert. Die meisten Schüler schreiben nun in ihrer Einleitung über Patriotismus, über den Stolz auf ihr Vaterland und dessen glorreiche Vergangenheit. Besonders besorgniserregend ist, dass diese Phasen häufig in keinerlei Zusammenhang mit dem stehen, was die Schüler dann schreiben: In der Regel erzählen sie eine bittere, tragische Geschichte, und wenn vom Krieg die Rede ist, geht es um den übermäßig hohen Preis, den jede Familie für den Sieg zu zahlen hatte. Heute kommen die Jugendlichen viel seltener zu dem Schluss, der sich nach der Lektüre eigentlich aufdrängt: dass sie durchaus stolz sein können, aber nicht auf Russland, nicht auf den Staat, der so mit seinen Menschen umsprang, sondern auf die eigene Urgroßmutter, die sich um die Kinder kümmerte, mit bloßen Händen eine Erdhütte grub, die Kinder rettete, aufzog, unterrichtete, zu selbständigen Menschen machte – und dies alles vor dem Hintergrund von Rechtlosigkeit, Hunger und Erniedrigung. Stolz könnten sie auch sein auf ihren Urgroßvater, der erst als „Kulak“ verfolgt und dann einberufen wurde und an der Front fiel – vor Smolensk, Königsberg oder Warschau. Darauf, dass die eigenen Angehörigen dort nicht nur überlebten, sondern Menschen blieben, ist ein echter Grund, stolz zu sein. Schlimm ist, dass die Jugendlichen diesen Zusammenhang nicht mehr herstellen. Er ist in den letzten Jahren verloren gegangen, und zwar deshalb, weil die Schüler genau begriffen haben, was die Urheber der neuen „glücklichen Identität“ von ihnen erwarten. Die Botschaft wird ja bereits in neuen Schulbüchern bekannt gegeben. Die Einstellung zum Krieg, zum Preis des Sieges, zur Vergangenheit wird auf diese Weise zu einer bloßen Hülle. Ein schlagendes Beispiel für ritualisierte, nichtssagende Symbolik, mit der die historische Wahrheit verborgen werden soll, ist die Aktion „Georgsbändchen“, bei der sich seit 2005 in den Wochen um den Jahrestag des Kriegsendes massenhaft junge Menschen schwarz-gelbe Bändchen anhängen und zu Parolen bekennen wie „Wir sind die Erben des großen Sieges“ oder „Ich erinnere mich, ich bin stolz“. In diesen Zusammenhang passt, dass erst kürzlich bei einer Umfrage des Levada-Zentrums auf die Frage „Wie fänden Sie es, wenn Stalin-Denkmäler aufgestellt würden?“ zwölf Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 24 Jahren mit „gut“ antworteten und 34 Prozent erklärten, es sei ihnen egal. Mit dem Leid der Kriegszeit und der Repressionen hat der Erinnerungskitsch nichts zu tun. Deshalb ist es so bitter, vor dem 65. Jahrestag des Kriegsendes, der wohl der letzte runde Jahrestag sein wird, den noch einige Kriegsteilnehmer erleben, die Worte zu lesen, die der mittlerweile verstorbene Nikolaj Nikulin an junge Menschen richtete: "Ein Volk, das seiner Toten nicht gedenkt, hat seine Würde verloren. Politische Repressionen, Lager, Kollektivierung, Hunger brachten nicht nur Millionen von Menschen um, sondern töteten auch den Glauben an das Gute, an Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Die Grausamkeit gegenüber dem eigenen Volk im Krieg, die Millionen Leben, die einfach so auf den Schlachtfeldern geopfert wurden, gehören zu demselben Phänomen. […] Der Krieg, der mit den Methoden des Konzentrationslagers und der Kollektivierung geführt wurde, hat keineswegs die Entwicklung der Menschlichkeit gefördert. Das Leben der Soldaten war nichts wert. […] Das Wichtigste ist es, bei den Menschen die Erinnerung und den Respekt den Toten gegenüber zu wecken. Diese Aufgabe geht weit über die Erinnerung an den Krieg hinaus, es geht um die Renaissance von Moral und Anstand, den Kampf gegen Grausamkeit und Gefühlsrohheit, Gemeinheit und Herzlosigkeit, die uns überschwemmt und gefesselt haben. […] Wenn auf dem Schlachtfeld Knochen zertrampelt werden, dann ist es dasselbe wie Lager, Kollektivierung, Rekrutenquälerei in der heutigen Armee. […] Kein Mahnmal, keine Gedenkstätte kann die ungeheuren Verluste des Krieges erfassen, kann die Myriaden sinnloser Opfer verewigen. Das beste Gedenken ist die Wahrheit über den Krieg, das aufrichtige Erzählen der Ereignisse, die Öffnung der Archive." Aus dem Russischen von Christiane Körner, Frankfurt am Main Irina Ščerbakova (1953), Historikerin, Leiterin des Bildungsprogramms von Memorial, Moskau Von Irina Ščerbakova erschien zuletzt in Osteuropa: Erinnerung in der Defensive. Schüler in Rußland über GULag und Repressionen, in: Das Lager schreiben. Varlam Šalamov und die Aufarbeitung des Gulag [= OE, 6/2007], S. 409–420. – Landkarte der Erinnerung. Jugendliche berichten über den Krieg, in: Kluften der Erinnerung. Rußland und Deutschland 60 Jahre nach dem Krieg [= OE, 4–6/2005), S. 419–432.
Volltext als Datei (PDF, 120 kB)