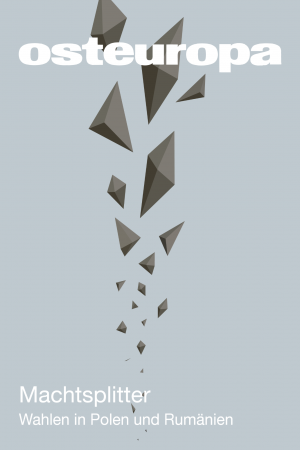Wahlen: Gründe und Abgründe
EditorialAbstract in English
(Osteuropa 6-7/2025, S. 3–4)
Volltext
Ist ein Präsident abwählbar, gar durch freie und gleiche Wahlen? Die Antwort auf diese Frage gibt Auskunft darüber, ob eine politische Ordnung eine Demokratie ist oder nicht. Die Verfassungen Russlands und Belarus sehen formal die Möglichkeit vor, dass das Volk den Präsidenten abwählt. Doch die Bürgerinnen und Bürger, die dieses Recht wahrnahmen, ihre Stimme abgaben, an die Objektivität des Wahlprozesses und der Stimmenauszählung glaubten und dann, als sie erkennen mussten, dass das Recht gebeugt und das Wahlergebnis manipuliert wurde, ihr Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit nutzten, gegen die Wahlfälschung protestierten und Neuwahlen forderten, bezahlten ihr politisches Handeln mit ihrer Freiheit, ihrer Gesundheit und sogar mit dem Leben. Tausende politische Gefangene und über eine Million ins Exil getriebene Menschen legen heute Zeugnis vom Charakter dieser beiden Regime ab.
Polen teilt eine Grenze mit Russland und Belarus. Doch in Polen sind die Wahlen frei und gleich. Präsidenten treten ab, wenn ihre Amtszeit vorbei ist oder sie abgewählt werden. Verlieren Regierungsparteien ihre Mehrheit, erkennen sie die Niederlage an und gehen in die Opposition. Und die Parteien der Opposition streben nach der Macht, um ihre Ziele durchzusetzen. Das ist der Kern der Politik. Konsolidiert sei eine Demokratie, so einst der Politikwissenschaftler Juan Linz, wenn alle Parteien und Interessengruppen akzeptierten: „Democracy is the only game in town.“ Das klingt gut, doch eine Demokratie bedarf noch einiger weiterer Voraussetzungen als dieses Konsenses. Sie ist mehr als die bloße Mehrheitsherrschaft. Die rechtsstaatliche Beschränkung der Macht durch Gewaltenteilung und die unveräußerlichen Menschenrechte gehören zum Kern jeder Demokratie.
Seit zwei Jahrzehnten ist die polnische Gesellschaft zwischen einer Strömung, die für liberale Demokratie und die feste Verankerung in der Europäischen Union steht, und einem illiberalen, nationalkonservativen, souveränistischen Lager gespalten. Die Präsidentschaftswahlen vom Mai und Juni 2025 bestätigen diesen Befund. Der Nationalkonservative Karol Nawrocki hat sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den Liberalen Rafał Trzaskowski durchgesetzt. Gleichzeitig war eine Radikalisierung des einen Lagers zu beobachten: Im ersten Wahlgang waren 20 Prozent der abgegebenen Stimmen auf rechtsextreme Kandidaten entfallen!
Im Herbst 2023 hatten in Polen Parlamentswahlen stattgefunden. Damals wurde die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) abgewählt. Sie ging in die Opposition. Heute zeigt sich jedoch, dass ihre Politik über den formalen Machtwechsel hinaus fortwirkt. Die PiS hat in den acht Jahren ihrer Herrschaft die Grundlagen der Gewaltenteilung und des liberalen Rechtsstaats in einem Ausmaß unterminiert und deformiert, dass der Wahlausgang keine hinreichende Bedingung für die Überwindung dieser Deformationen ist. Die Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit lässt sich nicht in einer Legislaturperiode mit rechtstaatlichen Mitteln rückgängig machen. Das antipluralistische, illiberale System, das die PiS nach dem Vorbild der autoritären Ordnung in Ungarn unter Viktor Orbán errichtet hat, ist fester verankert als erwartet. Das ist ein Lehrstück für die liberalen Kräfte in Europa. Denn es zeigt, wie schnell die Grundlagen des liberalen Rechtsstaats unterminiert werden können und wie schwierig es ist, diese Minen zu bergen und zu entschärfen.
Ein Lehrstück ganz anderer Art boten die Präsidentschaftswahlen in Rumänien. Sie waren ein Drama in drei Akten. Der erste Akt war der erste Wahlgang am 24. November 2024. Aus ihm ging überraschend der zuvor weitgehend unbekannte exzentrische Rechtsextremist Călin Georgescu als Sieger hervor. Im zweiten Akt trat das rumänische Verfassungsgericht auf den Plan: Am 6. Dezember 2024 annullierte es die Präsidentschaftswahlen wegen eines „aggressiven russischen hybriden Angriffs“, dem Georgescu seinen Sieg verdanke. Als Quelle fungierte der Inlandsgeheimdienst. Doch Bukarester Investigativjournalisten führten den Nachweis, dass die TikTok-Kampagne für den Russlandfreund Georgescu, die von fast 30 000 falschen Konten und 1,3 Millionen erfundenen Followern befeuert wurde, nicht in Moskau, sondern in Bukarest in Auftrag gegeben worden war. Dahinter steckte die Regierungspartei der Nationalliberalen, die mit Hilfe dieser Kampagne die potentiell aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten zugunsten ihres Bewerbers zu schwächen versuchte. Das Kalkül war, dass der eigene Bewerber in der Stichwahl gegen einen Rechtsextremisten wie Georgescu höhere Chancen auf den Sieg haben dürfte. Als die Operation aus dem Ruder lief, zog das Machtkartell die Notbremse und machte seinen Einfluss auf das Verfassungsgericht geltend. …
Mit der Idee von freien und fairen Wahlen hat all das wenig zu tun. Die investigativen Journalisten zeichneten mit ihren Recherchen ein Sittengemälde des Zynismus der herrschenden Elite. Und dass im dritten Akt, bei den neu angesetzten Präsidentschaftswahlen im Mai 2025, mit George Simion der nächste Rechtsextremist antrat und fast die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigte, überrascht kaum, wenn man an die Verankerung antiwestlicher, antiliberaler und ultranationalistischer Traditionen in der politischen Kultur Rumäniens denkt. Nur die starke Wählermobilisierung in der Stichwahl verhinderte den Sieg des Rechtsextremisten.
Die Polarisierung ist die Signatur der heutigen Demokratien – nicht nur in Europa. Durch Stichwahlen wird diese Polarisierung zusätzlich befördert. Und dennoch bleiben Wahlen und – wie die Leistung der Journalisten aus Rumänien wieder zeigt – eine unabhängige und kritische Öffentlichkeit notwendige Bedingungen für jede Demokratie.
Berlin, im Juli 2025 Manfred Sapper, Volker Weichsel