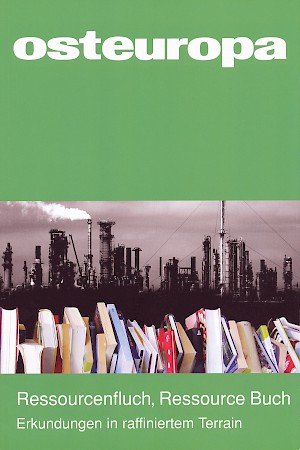Unding Tschernobyl
Erinnerung an das Frühjahr 1986
Volltext als Datei (PDF, 137 kB)
Abstract in English
Abstract
Von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl waren 23 Prozent der Landesfläche von Belarus betroffen: 3678 Dörfer und Städte, in denen mehr als eine halbe Million Menschen lebten. Die sowjetische Informations- und Evakuierungspolitik hat jedoch dafür gesorgt, dass das Unglück und seine Folgen praktisch keinen Platz im Bewusstsein der Gesellschaft fanden. Die Bewohner der 415 „Zonen“-Dörfer wurden jeweils nicht gemeinsam umgesiedelt, sondern über Tausende Dörfer und Städte in ganz Belarus verteilt. So wurde ihre Erinnerung und die Erinnerung an sie pulverisiert. Auch nach 25 Jahren bleibt Tschernobyl selbst für die unmittelbar Betroffenen ein blinder Fleck. Zeit, einen Blick zurück auf den ersten Monat nach der Katastrophe zu werfen.
(Osteuropa 7/2011, S. 95–106)
Volltext
Kein Staub mehr da . . .
Der Staub ist fort, verweht. Ein rauer Wind wirbelt feine Sandkörner auf und peitscht sie gegen Gesicht, Beine und Brust. Ich komme mir vor wie in einem Himbeer- oder Brombeergestrüpp. Dabei gehe ich einfach durch die Stadt, durch Homel’, und frage mich: Wieso bläst heute dieser scharfe, unnachgiebige, zudringliche Wind? Wie kommt er dazu, plötzlich den Sand von der Ukraine nach Belarus zu fegen und von hier weiter in Richtung Moskau?
Ich wusste noch nichts, ahnte noch nichts, und trotzdem kann ich mich noch genau an diesen Tag und den Abend des 26. April 1986 in Homel’ erinnern, ich weiß noch, dass ich unfähig war, etwas anzufangen, alles ringsum schien von einem stummen Schrei erfüllt. Einem stummen Schrei, mit dem alles Leben und selbst das Unbelebte, selbst Staub und Sand dem Unheil zu entfliehen versuchten. So fliehen Elche und Wildschweine, Wölfe und Rehe, Hasen und Eichhörnchen vor einem unbarmherzigen Waldbrand – stumm und mit weit aufgerissenen Augen. So fliehen Schlangen und Nattern, Käfer und Raupen, mit einem stummen Entsetzensschrei krepieren sie auf der Flucht.
Entsetzen lag an diesem Tag über Homel’, über Polessien, über dem ganzen Land, das konnte ich spüren, ohne zu wissen, wo was geschehen war, ohne zu ahnen, dass überhaupt irgendwo etwas geschehen war. Ich wollte die Hände vors Gesicht schlagen, Augen und Ohren verschließen, mich in eine Grube, eine Höhle oder einen Spalt verkriechen und mich dort hinkauern, oder fortlaufen von hier, ebenfalls mit weit aufgerissenen Augen, nur fort . . .
Aber wohin und warum? Wieder und wieder versuchte ich mich zur Ordnung zu rufen. Reiß dich am Riemen, die Sonne scheint (wenn es auch windig und schon Abend ist), und deine Frau geht gleich los zur Spätschicht – Samstagabend. Am Tag zuvor war ich von einer Dienstreise durch die Gegend um Vetka zurückgekommen. Ich arbeitete als Landwirtschaftskorrespondent bei der örtlichen Regionalzeitung und sollte für die nächste Ausgabe etwas über die Aussaat zusammenschreiben, „der Frühlingstag nährt das Jahr“ usw. Aber ich hatte keine Lust und schob den Moment am Tisch vor dem leeren Blatt immer weiter hinaus . . .
„Ich geh dann los“, sagte meine Frau.
„Ich bring dich noch zur Haltestelle“, griff ich nach dem nächsten Strohhalm.
„Nein, lass nur, du musst doch noch arbeiten . . .“
Ich blieb allein zurück, allein mit meinem Weltschmerz, der sogar die Schreibmüdigkeit zudeckte. Wieder stand ich am Fenster und sah den Film, in dem meine Frau, die künftige Mutter meiner Kinder, klein, schutzlos und einsam, in gebückter Haltung durch den unerträglich schneidenden Wind einer menschenleeren Stadt geht.
Die Stadt war leer, am Wochenende waren die meisten vom Land Zugezogenen auf der Datscha oder in ihren früheren Dörfern auf dem Feld. Nur was gesät wurde, konnte man auch ernten, der Frühlingstag nährte tatsächlich das Jahr. Nach fast siebzig Jahren totalitärer Sowjetherrschaft waren wir so weit, dass die Läden praktisch leer standen, Fleisch nur in bestimmten Geschäften erhältlich war und Hühnchen höchstens noch zu besonderen Feiertagen „ausgegeben“ bzw. auf den viel zu großen Markt geworfen wurden. Gemüse gab es ausschließlich auf Märkten, und es kam nicht etwa aus den Kolchosen, sondern aus privatem Anbau oder gar aus dem Kaukasus. Wer nicht Kartoffeln, Kohl, Rote Bete, Gurken und Tomaten auf seinen sechs Hektar Land oder dem elterlichen Hof anbaute und sich Vorräte für den Winter zulegte, hatte nichts zu essen.
Ich setzte mich an diesem Abend nicht mehr an meinen „Beitrag“, ich konnte mich nicht überwinden. Stattdessen ging ich in unserer Einzimmerwohnung auf und ab, las hier etwas, blätterte dort, schaltete den Fernseher ein und hoffte auf den freien Sonntag. Der Abend wurde zur Nacht, einer langen Nacht, in der ich ein ums andere Mal aus schlimmen Träumen hochschreckte, Alpträumen, Schreckensvisionen, aber letztlich doch nur Träumen ohne konkreten Hintergrund. Später erzählten mir fast alle Freunde von einer ähnlich furchtbaren Nacht. Alle hatten sie ihre Schlaflosigkeit als Einzelerscheinung abgetan und die Gründe dafür bei sich selbst gesucht.
Auch der nächste Tag, ein Sonntag, war in Homel’ wieder trocken und stürmisch – sturmtrocken. An manchen Stellen war die Erde blankgefegt und hart wie Asphalt. Den ganzen Sand hatte es aus der Stadt geblasen.
Nachmittags gegen vier machten meine Frau und ich unseren üblichen Spaziergang. Die Erde verlangte nach Regen, aber der blieb aus, dabei zogen hoch am Himmel unentwegt tiefdunkle Wolken vorüber. Eine Spannung lag in der Luft, im Rauschen der Bäume, in allem, wie eine zum Zerreißen gespannte Saite, eine Spannung, die körperlich spürbar war. Wie vor einem Gewitter, das jeden Moment losbrechen muss, aber der erste Tropfen will einfach nicht fallen.
Deshalb drehten wir nur eine kurze Runde und kehrten ungewohnt matt und missmutig wieder zurück. Ich wusste immer noch nichts. Spät erst, viel später las ich den legendären Satz eines Wissenschaftlers über jene Apriltage: „Glücklicherweise wehte der Wind nicht Richtung Kiew“. Der Autor dieser Zeilen hatte beim Schreiben entweder nach guter sowjetischer Tradition gar nicht gedacht, oder nur an sich selbst. Wohin der Wind an jenem Tag auch wehte, er brachte nur Unheil. In erster Linie über mein Belarus.
Ich wusste von nichts. Zur selben Zeit, gegen siebzehn Uhr, waren meine Eltern am 27. April mit einigen Nachbarn auf der Rückfahrt von Kiew. Der kürzeste Weg nach Chojniki über Pryp”jat’ wurde ihnen verwehrt, aus der Stadt, durch die sie am Morgen des Vortages noch gefahren waren, kam ihnen jetzt eine endlose Kolonne von Bussen und voll besetzten Autos entgegen, während in der Gegenrichtung ein Heer von Schützenpanzerwagen und Militärtransportern mit Soldaten auf die Stadt zurollte.
Auch meine Eltern in ihrem Bus wussten von nichts. Soldaten mit Gasmasken am Gürtel und seltsamen weißen Schutzmasken vor Mund und Nase hatten den Bus angehalten und schickten ihn nun wortlos, ohne Erklärung immer weiter westlich, Richtung Mazyr statt nach Chojniki.
Irgendwie sickerte das Wort „Evakuierung“ in den Bus – ein Wort, das für die polessische Zunge zwar unaussprechlich ist, aber aus Kriegszeiten noch allgemein bekannt. Im Bus saßen vor allem Kinder des letzten Krieges, die in den 40er Jahren zwischen fünf und zehn Jahre alt gewesen waren. Deshalb machte gleich noch ein zweites, schrecklicheres Wort die Runde: „Krieg!“
Was für ein Krieg? Gegen wen und warum? Hatten die Amerikaner angegriffen? Oder vielleicht wieder die Deutschen? Wieso waren die Soldaten hier und nicht an der Grenze bei Brėst? Und wie sollte man jetzt nach Hause kommen zwischen all diesen Bus- und Autokolonnen und den Militärkordons? Nach Hause, nach Belarus, zu den Kindern, den Enkeln? Bloß schnell nach Hause! Schrecklich sahen sie aus, die Gesichter hinter den Scheiben der Busse aus Pryp”jat’, die sie durch die Scheiben ihres Busses erkennen konnten: Nirgends ein Lächeln (woher auch!), schockierte, versteinerte Minen, die Augen weit aufgerissen angesichts der überraschenden, überstürzten Abreise, deren Anlass und Ziel im Dunkeln blieben.
An einer der vielen Umleitungen sprang der Fahrer schließlich aus dem Bus und wandte sich an einen älteren Soldaten mit Sternen auf den Schulterklappen, der ihm leise, quasi im Vertrauen erklärte, das sei kein Krieg, niemand hätte uns angegriffen, kein Grund zur Sorge. Nur eine Evakuierung, weil es in Pryp”jat’ am Atomkraftwerk einen Unfall gegeben hätte, einen Brand, deshalb würden die Leute jetzt vorübergehend in sichere Entfernung gebracht. Vorübergehend . . .
Ein Brand. Gleich wurde es allen leichter ums Herz: Ein Unfall, bloß ein Feuer. Ein Feuer, kein Krieg. Nicht bei uns, sondern dort, in Tschernobyl, im Kraftwerk. Das hat nichts mit uns zu tun, zu Hause ist alles in Ordnung. Plötzlich hatte das Wort „Evakuierung“ einen anderen Klang, war beruhigend, schlicht und vertraut.
Das gespannte Schweigen war dahin, alle erinnerten sich und erzählten wild durcheinander: Tags zuvor im Morgengrauen, als sie noch am belarussischen Ufer des Prypjac’ bei Chojniki gestanden und auf die Fähre in die Ukraine, nach Janaŭ gewartet hatten (so nannte man hier noch immer die eigens für die Kraftwerksangestellten gebaute Stadt Pryp”jat’, die neben dem Dorf Janaŭ lag), hatten sie im Nebel über der Stadt eine Feuersäule gesehen, riesengroß, bis in die Wolken, vielleicht kilometerhoch, aber nicht beängstigend, als gehörte sie hier hin. Nicht rot war sie, eher himbeerfarben, so ähnlich wie in dem Aladin-Film, wenn der Geist aus der Lampe entweicht. Man wartete förmlich darauf, dass er gleich am Himmel erscheinen und ein Lachen aus seinem Riesenmund herunter schicken würde. Schon in diesem Moment hatten die Menschen unwillkürlich gespürt, wie winzig sie angesichts dieses Kraftausbruchs waren.
Sie waren aus dem Bus gestiegen, um an dem nasskalten Morgen das „Naturschauspiel“ gebührend zu bewundern. Da standen sie und dachten nicht im Entferntesten an ein Unglück, zu tief saß der Glaube an das „friedliche Atom“. Dann fuhren sie durch das schlafende Janaŭ, das ihnen mit seinen gelben Ampelaugen zublinzelte, und nahmen Kurs auf Kiew.
Sie übernachteten im Hotel, deckten sich mit Leckereien und Geschenken für zu Hause ein, die lang entbehrte Kochwurst für 2,20 . . . Kiew war mit Nahrungsmitteln weit besser versorgt als Homel’ oder auch Minsk. Entsprechend fröhlich und aufgekratzt machte man sich wieder auf den Heimweg.
Und dann auf einmal: Evakuierung! Und warum? Bloß wegen eines Feuers, das sie am Vortag selbst gesehen hatten! Wäre nur nicht diese auffallende Hektik gewesen, die Angst, die einem die uniformierten Militärs und die endlosen Fahrzeugkolonnen mit ihren ernst dreinblickenden Insassen einjagten, die doch selbst nicht wussten, weshalb man sie zusammengetrommelt, in Busse verfrachtet und auf eine Reise ins Unbekannte geschickt hatte. Wären nicht hinter den Busfenstern ihre angsterfüllten, übergroßen Augen gewesen, aus denen Verwirrung und Verzweiflung sprachen, bei den Kindern vor allem, und hätte nicht allgemeine Ratlosigkeit und ein Nebel des Nichtwissens über allem gelegen – was wäre schon gewesen? Ein Brand eben, Feuer, Rauch, nichts weiter. Immer noch Sonnenschein und grüne Natur. Strahlung könnte ausgetreten sein? Weil es doch ein Atomkraftwerk sei? Iwo, was denn für eine Strahlung! Wo denn? Zeigt sie uns doch. Da ist nichts. Nichts zu sehen, nichts zu hören. Es riecht nicht, stinkt nicht, brennt nicht, beißt nicht . . .
In bald 70 Jahren Sowjetherrschaft hatten die Menschen gelernt zu parieren, sie folgten den Anordnungen von Militärs und Polizisten, die selbst nicht Bescheid wussten und einiges riskierten, die das Ganze als merkwürdige Übung sahen und die Befehle ihrer deutlich besser informierten Vorgesetzten ausführten, die ihrerseits nach verantwortlichen Vorgesetzten suchten. Und so wurden die Einwohner von Pryp”jat’ nicht sofort, einige Stunden nach dem Unfall (nein, der Katastrophe!) evakuiert, sondern erst nach anderthalb Tagen. Denn die globale Tragödie sollte zu einem kleinen, gemütlichen Zwischenfall in der Provinz, zunächst sogar nur einer einzigen Stadt zusammenschrumpfen. Mancher schaute sich arglos das Feuer an, Tausende wurden einer tödlichen Strahlendosis ausgesetzt, bis endlich eine Entscheidung fiel.
Montag, 28. April, morgendliche Redaktionssitzung der Homel’skaja praŭda. Keine Rede von Tschernobyl, von Strahlung oder Risiko sowieso nicht. Noch vor wenigen Wochen, nach dem Vorfall in Smolensk, hatte es ein kurzes Gespräch gegeben.
Der Chefredakteur begann wie immer mit einem flotten Spruch und ließ sich nichts anmerken, dabei musste er schon informiert sein. Dann stimmte er uns auf die bevorstehende arbeitsreiche Woche ein. Der 1. Mai stand vor der Tür, dafür musste eine Brigade zusammengestellt werden, eine Namensliste für die Druckereibereitschaft und eine Mannschaft, die die Feiertags-„Fische“ vorbereitete.
„Fisch“ hieß bei uns eine Vorab-Reportage über die Mai-Feiern (das war zu Sowjetzeiten überall gängige Praxis, vom Kreisblatt bis zur Pravda). Das Drehbuch wurde in den Ideologieabteilungen der Gebiets- und Kreiskomitees geschrieben: Wer marschiert wo, welcher Betrieb oder Kolchos eröffnet den Zug, wer bildet das Schlusslicht, welche Glückwünsche kommen von der Tribüne, wer grüßt von dort die Arbeiter, wer trägt welche Banner, Losungen und Porträts (Politbüromitglieder, Lenin mit Marx-Engels) – alles war bis ins Kleinste durchgeplant. Nach diesem Drehbuch schrieben die Journalisten ihre Reportage und gaben den „Fisch“ am Vorabend des Feiertags in Druck und Satz. Sonst würde die Ausgabe nicht rechtzeitig fertig und könnte die Leser nicht „operativ“ über das bedeutende Ereignis im Leben des sowjetischen Volkes informieren.
Operativ!
Ein ungeheuer wichtiges Wort im Sowjetjournalismus! Von der Tragödie in Tschernobyl dagegen wussten nicht einmal die Journalisten des nächstgelegenen „Organs des Gebietskomitees der Partei“ . . . So bringt man das Volk um die Wahrheit. Hier hatte man, wahrhaftig operativ, alle Informationskanäle dicht gemacht.
Aus heutiger Sicht ist das kaum vorstellbar, im Zeitalter von Internet und Mobilfunk geht jede noch so unbequeme Nachricht in Sekunden um die Welt. Aber damals gab es in unserem gar nicht mal so kleinen Dorf nur im Kolchosbüro und bei der Post ein Telefon. Um mich anzurufen, hätten meine Eltern zur Post gehen, ein Gespräch anmelden und lange auf die Durchstellung warten müssen. Sie haben nicht angerufen. Ich konnte sie ohnehin nicht erreichen.
Erst gegen Ende des Arbeitstages ging in der Redaktion das Gerücht, in Tschernobyl sei etwas passiert. Kein Unfall, sondern „etwas“, ein Feuer, vielleicht eine Explosion. Aber das war nur Geflüster unter Kollegen, ungewiss und nicht weiter schlimm.
In hektischer Feiertagsvorbereitung verging auch der 29. April, am 30. teilte die Moskauer Pravda in einer winzigen Notiz mit, in Tschernobyl habe es wohl in einem der Kraftwerksreaktoren einen Unfall gegeben: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Strahlungssituation im Kraftwerk und der Umgebung stabil, die Betroffenen erhalten die notwendige medizinische Versorgung.“ Wie hübsch: „im Kraftwerk“. Und es kam noch besser: „Die Bewohner der AKW-Siedlung und dreier nahe gelegener Ortschaften wurden evakuiert“. Die „AKW-Siedlung“ war die Stadt Pryp”jat’, in der damals rund 45 000 Menschen lebten! So geschickt hat man damals wichtige „Informationen aufbereitet“, „Druck abgebaut“ und Gerüchte abgestellt. Wozu auch das Volk vor dem großen Festtag aufscheuchen . . . Was sind schon 45 000 Menschen angesichts eines 250-Millionen-Landes . . .
Am 1. Mai brachen meine Frau Ljudmila und ich gegen neun Uhr auf, um der Schwiegermutter, die auf dem Land wohnte, beim Kartoffelsetzen zu helfen. Die Sonne schien seit dem Morgen, und es war so schön hier draußen, so warm und gegen Mittag sogar heiß, dass ich das Hemd auszog und mir beim Mistunterheben die erste Bräune holte.
Nach getaner Arbeit setzten wir uns und sahen, dass schon der Sauerampfer zartgrün am Feldrand stand. Wir sammelten einige Stängel für den ersten Frühlingsborschtsch und machten uns beschwingt auf den Weg zurück nach Homel’.
Meine Frau bereitete gleich das Essen vor, ich schaltete das Radio an. Ich drehte den Regler, bis ich einen mir unbekannten russischen Sender hereinbekam. Trotz Knistern und Rauschen konnte ich verstehen, dass es „Radio Schweden“ war. Eine Nachrichtensendung. Ich kann nicht wörtlich wiedergeben, was ich hörte, erinnere mich aber genau an den Inhalt: Im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine habe sich ein schrecklicher Unfall ereignet, der Reaktor in Block IV sei explodiert. Von radioaktiver Strahlung seien die Ukraine, Belarus und die angrenzenden Länder betroffen. Selbst in Schweden wurden erhöhte Werte gemessen. In der Ukraine und in Belarus, besonders im Raum Homel’, solle man sich möglichst nur in geschlossenen Räumen aufhalten, Jod einnehmen und besonders darauf achten, keine Radioaktivität über verstrahlte Nahrung aufzunehmen, also frisches Gemüse meiden: Zwiebeln, Salat, Sauerampfer . . .
Ich glaubte der Meldung sofort. Sauerampfer? Der Borschtsch war gerade fertig – köstlicher Frühlingsgeruch zog ins Zimmer, meine Frau wollte eben die Teller füllen. Ich sprang auf, riss ihr den Topf aus der Hand, rannte ins Bad und schüttete den Borschtsch ins Klo. Dann versuchte ich meiner fassungslosen Frau irgendwie zu erklären, was geschehen war, ohne es selbst ganz begriffen zu haben. So trat das schreckliche Wort auch in unser Leben: Strahlung.
Währenddessen waren im Fernsehen fröhliche Menschen bei der Parade zum 1. Mai zu sehen, mit Blumen und Luftballons. Lächeln, begeistertes Winken in die Kameras: Wir werden gefilmt! In Moskau, in Kiew, in Minsk, in Homel’, in Chojniki, in Brahin, in Naroŭlja . . . „Es lebe der 1. Mai, das Fest der progressiven Menschheit!“ „Es lebe die sowjetische Presse, die wahrhaftigste Presse der Welt!“
Aber die Angst hatte nicht nur mich gepackt. Sicher hatten auch noch andere „Radio Schweden“ gehört. Die Information hatte sich nicht hinter den Eisernen Vorhang sperren lassen. Tschernobyl war nicht Čeljabinsk, sondern Europa, und Strahlung hält sich bekanntlich nicht an Grenzen. Trotzdem konnte man niemanden fragen, was passiert war. Und doch, noch einmal, ich glaubte den Schweden aufs Wort, zumal sie auch gesagt hatten, dass sogar die Weiden der Rentiere verstrahlt und die Tiere selbst betroffen seien. Sie würden geschlachtet und das Fleisch vernichtet. Wenn es in Schweden schon so schlimm ist, was ist dann bei uns, dachte ich unwillkürlich.
Bei unserer Rückkehr hatte ich die Zeitungen aus dem Briefkasten geholt, das fiel mir jetzt wieder ein. Und was war dort fünf Tage nach dem Unfall zu lesen? Nichts, Vorab-Reportagen über die erfolgreichen Feierlichkeiten. Nur in der Sovetskaja Belorussija fand sich eine Mitteilung des „Ministerrats der UdSSR“, im gewohnten heuchlerischen Ton: „Wie bereits der Presse zu entnehmen war [wo? wann? eine kleine Notiz in der Pravda], kam es im Kraftwerk Tschernobyl [wieder das „Kraftwerk“], 130 Kilometer nördlich von Kiew, zu einem Unfall. Eine Regierungskommission ist vor Ort . . . Ersten Angaben zufolge ereignete sich der Unfall in einem der Räume [!] von Block IV und führte zur Zerstörung der baulichen Konstruktion [!] des Reaktorgebäudes [!] sowie seiner Beschädigung und zu einem gewissen [!] Austritt radioaktiver Substanzen . . . “ Und weiter: „Infolge der eingeleiteten Maßnahmen konnte der Austritt radioaktiver Substanzen in den vergangenen Tagen eingedämmt und das Strahlungsniveau um das AKW und in der Siedlung verringert werden“.
Und um die Belarussen endgültig zu beruhigen: „Einige westliche Agenturen verbreiten Gerüchte, wonach bei dem Unfall im AKW Tausende Menschen umgekommen seien. Tatsächlich gab es, wie bereits gemeldet, zwei Tote und 197 Verletzte. Davon haben 49 nach ärztlicher Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen. In Betrieben, Kolchosen, Sowchosen und Behörden läuft der normale Betrieb.“
Diese Nachricht ließ uns erst recht aufhorchen, hatten wir doch in der Sowjetunion gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen und den „Gerüchten“ zu glauben, die „westliche Agenturen“ verbreiteten.
Am 2. und 3. Mai versuchte ich vergeblich, die Verwandtschaft im Kreis Chojniki, im nicht einmal 80 Kilometer von Tschernobyl entfernten Dorf Vjaliki Bor telefonisch zu erreichen. Ich rief natürlich bei der Post an, wo eine Nachbarin arbeitete. Aber die Regierung hatte die Tage vom 1. bis 4. Mai für arbeitsfrei erklärt, und die Post war geschlossen. Ich wusste, dass meine Schwestern, die in Minsk und Hrodna wohnten, in diesen Tagen meine Eltern besuchen wollten, und mir war klar, dass auch sie nicht ahnten, was ganz in der Nähe geschehen war.
Ich bekam keine Verbindung. Nicht etwa, weil die Post geschlossen hatte, ich hörte ständig kurze Signaltöne, das hieß wohl „Leitung überlastet“. Noch so ein „geschickter Zug“ der Regierung, um die Informationskanäle in beide Richtungen dicht zu machen.
Am 4. Mai war Ostersonntag, und in der Nacht vom 3. auf den 4. begann die Umsiedlung der Bewohner aus den belarussischen Landkreisen Brahin, Chojniki und Naroŭlja, der sog. 30-km-Sperrzone. Endlich, eine Woche nach der Katastrophe. Manche der betroffenen Dörfer lagen weniger als zehn Kilometer von der ukrainischen „Siedlung“ Pryp”jat’ entfernt.
Von den „Tschernobylcy“ aus der Reaktorgegend, die in mein Heimatdorf umgesiedelt wurden, ist heute praktisch keiner mehr am Leben. Zuerst hat Tschernobyl die Männer um die fünfzig erwischt, dann die Älteren und schließlich die Frauen. Jetzt holt der Tod die Kinder und Enkel der „Tschernobylcy“.
Und wie lange noch? Wissenschaftler gehen davon aus, dass in 200 Jahren der Cäsiumgehalt hier im Boden nur um 1 Prozent gesunken sein wird. Und Strontium-90, Americium-241, Plutonium? Die Halbwertszeit von Plutonium-239 liegt bei 24 390 Jahren. In dieser Gegend ist bald das gesamte strahlende Periodensystem der Elemente niedergegangen. Bis heute leben und arbeiten Hunderttausende auf verstrahlter Erde und bauen hier ihre „sauberen Erzeugnisse“ an. Sie bekommen keine Vergünstigungen mehr, und eine Kur ist für viele zu teuer. So sucht sich Tschernobyl mit freundlicher Unterstützung einer prinzipienlosen, gleichgültigen Beamtenschaft weiter seine Opfer.
Aber zurück zu jenen Tagen.
Auch nach fast siebzig Jahren unter den Sowjets war Ostern für uns noch das wichtigste Fest des Jahres. Das wollte besonders sorgfältig vorbereitet sein. Am Gründonnerstag harkten alle Abfälle und altes Laub zusammen, um es zu verbrennen, man kehrte die Höfe, wischte die Böden und ging in die Badestube. Am Freitag und vor allem am Samstag bereitete meine Mutter all die Leckereien für die kommenden Tage vor. Dann der Samstagabend – vor der Messe entfachte die Dorfjugend große Feuer, sprang und tanzte, die Burschen drückten die Mädchen, die Mädchen kreischten, liefen aber trotzdem nicht nach Hause . . . Und da kamen die Busse mit den Umsiedlern.
„Umsiedler“ oder, schlimmer noch, „Tschernobylcy“ nannte man sie erst später. Zuerst waren es einfach Menschen, verschreckte, aufgeregte Menschen, die selbst nicht wussten, wie ihnen geschah. Sie hatten sich binnen zwei Stunden an den zentralen Plätzen ihrer Dörfer einfinden müssen, vor dem Geschäft, dem Dorfsowjet oder der Kolchosverwaltung, und sie durften nur das Nötigste mitnehmen, Papiere und Proviant für einen Tag. Alles andere war streng verboten, man hatte ihnen gesagt, sie führen für ein paar Tage weg. Also ließen sie ihr Hab und Gut zurück und zwängten sich weinend in die Busse. Sie spürten wohl, dass es schlimmer stand, ahnten aber nicht, dass sie ihre Heimat für immer verließen.
Bei meinen Eltern wurde eine Großfamilie aus Masany, einem acht Kilometer von Tschernobyl entfernten Dorf, mit Großeltern, Tochter, Schwiegersohn und Enkeln einquartiert. Sie legten ihre kleinen Bündel in die Ecke und vergingen schier vor Kummer und Scham, dass sie während der Feiertage einfach so bei Fremden eingefallen waren. Schweigend saßen sie stocksteif da und sahen meine Eltern an, die, selbst wie benommen, nicht wussten, was sie mit diesen Leuten anfangen, wie sie mit ihnen umgehen sollten. Aber das Osterfest half, die Gräben zu überwinden und alle miteinander bekannt zu machen. Am nächsten Morgen saß man gemeinsam zu Tisch, stieß auf das Fest an und kam ins Gespräch.
Immer wieder wurde deutlich, dass die Umsiedler schnell wieder nach Hause wollten, wo es ihnen so gut gegangen war, wo sie Haus und Hof und ihre gesamte Habe zurückgelassen hatten. Sie zweifelten keine Sekunde daran, dass die Umsiedlung nur vorübergehend war, sie wollten den Gedanken nicht zulassen, sie könnten nie wieder zurückkehren. Es war ja auch alles so schnell gegangen, obwohl sie schon in den letzten Tagen beim Anblick all des militärischen Geräts und Tausender Soldaten geahnt hatten, dass sie nicht ungeschoren davonkommen würden. Kühe und Schweine hatten sie noch zusammengetrieben und verladen, zwei Stunden später saßen sie selbst mit ihren Bündeln im Bus.
Die Umsiedler lebten eine Woche bei meinen Eltern und freundeten sich mit ihnen an, dann wurden sie wieder in Busse gesteckt und irgendwohin gefahren. Nicht nach Hause, natürlich. In den Kreis Žlobin, hieß es. Wir haben nie wieder von ihnen gehört.
An dieser Stelle noch ein kleiner Einschub: Als klar wurde, dass die Umsiedlung nicht auf Zeit, sondern endgültig war, baten viele darum, am neuen Wohnort gemeinsam untergebracht zu werden, das ganze Dorf oder wenigstens die Straße. Sie wollten nicht geteilt und zerstreut werden, nicht Fremde unter Fremden sein. Aber die Behörden ignorierten diesen Wunsch. Sie verteilten die Bewohner der 415 „Zonen“-Dörfer über Tausende Dörfer und Städte in ganz Belarus und pulverisierten ihre Erinnerung und die Erinnerung an sie. Dabei war jedes Dorf ein Unikat, eine authentische und einmalige Welt mit eigenen Traditionen und charakteristischer Sprache, mit Überlieferungen und Legenden, mit eigenen Bezeichnungen für die umliegenden Orte, Wälder, Bäche, Quellen und Felder. Auch nach 24 Jahren ist das Erbe Tschernobyls noch nicht geborgen, noch immer gibt es kein belarussisches Pantheon der verlorenen, verschwundenen Dörfer.
Dass die Behörden den Umsiedlern nicht entgegenkamen, zeugt ein weiteres Mal von der „Umsicht“ und dem Wissensstand über die Folgen der Katastrophe. Die meisten „Tschernobylcy“ aus der belarussischen 30-km-Sperrzone sind in den ersten zwanzig Jahren nach ihrem „Umzug“ verstorben. Wären ganze Dörfer und Straßenzüge weggestorben, hätte man das mitbekommen. So aber sind die „Tschernobylcy“ fast unmerklich verschwunden, ohne die Statistiken einzelner Kreise, Dorfsowjets oder Dörfer zu belasten.
Von offizieller Seite wurde mit allen Mitteln für Ruhe und Stabilität gesorgt, äußerlich sollte nichts auf das große Unglück hindeuten, das über das Land gekommen war. Dabei war die Lage weit schwieriger, als man in Chojniki, Brahin, Homel’ und erst recht in Sachalin annehmen konnte.
Die Verantwortlichen wussten nicht, was sie mit dem vierten Reaktorblock anstellen sollten, eine neuerliche Explosion war jederzeit möglich, auch konnte der Brand auf Block III übergreifen. Der Wind wehte nach Belarus und trug radioaktive Wolken weiter Richtung Moskau. Es war nicht mehr auszuschließen, dass die 30-km-Sperrzone auf 100 Kilometer ausgeweitet werden musste.
Für die radioaktiven Wolken fand man eine denkbar einfache Lösung: Man ließ sie hinter Homel’ im Raum Vetka, Čačėrsk und über einem Teil des russischen Gebiets Brjansk, über den Kreisen Krasnaja Gora und Novozybkov abregnen. So bedeckte der Fallout die Ufer der großen belarussischen Flüsse Prypjac’, Dnjapro und Sož. Geografisch gesehen ging die Asche Tschernobyls also über der Ukraine, Belarus und Russland nieder, ethnisch betrachtet traf sie fast ausschließlich die Belarussen. Denn auch das ukrainische Gebiet Černigiv um Tschernobyl und das heute russische Umland von Brjansk ist hauptsächlich von Belarussen bewohnt. Um sich davon zu überzeugen, muss man nur einen Blick in ethnografische Karten werfen oder zuhören, wie die Menschen in der Region, besonders die Alten, miteinander sprechen.
Im Rückblick auf die letzten April- und die ersten Maitage 1986 glaube ich heute, dass nur die Unwissenheit der Bevölkerung und die Feiertage Partei und Regierung vor einer Welle der Gewalt und Panik in Homel’ und Umgebung bewahrt haben (dasselbe gilt für Kiew). Zunächst der Tag der Arbeitersolidarität (1.–2. Mai), dann das orthodoxe Osterfest (4. Mai), dann, weniger wichtig, aber in der UdSSR doch nicht unwesentlich, der Tag der Presse (5. Mai), der Tag des Rundfunks (7. Mai), schließlich der Tag des Sieges (9. Mai) und der Totengedenktag am 13. Mai. In diesen zwei Wochen, die das Schicksal Gorbačev und seiner Mannschaft geschenkt hat, konnte man die Lage einigermaßen in den Griff bekommen. Zumindest verhinderten die mutigen Soldaten, die den Brand löschten und den Sarkophag über dem explodierten Reaktor errichteten, eine zweite Explosion.
Erst nach dem 9. Mai konnte ich eine Dienstreise in die Heimat und zu meinen Eltern organisieren, da waren meine Schwestern schon wieder abgereist. Ich musste über die Helden schreiben, über die das Unheil von Tschernobyl gekommen war. Heldentum und große Taten gab es zur Genüge, aber wozu waren sie gut? Und haben die „Helden“ wirklich begriffen, welchen Preis sie für ihren Einsatz würden bezahlen müssen? Sicher nicht. Die Menschen begehrten nicht auf, weil sie einfach nicht Bescheid wussten. Keiner dachte an radioaktives Jod oder an die in den ersten Tagen nach dem Unglück so gefährlichen „heißen Teilchen“. Außerdem hat der Regierung „geholfen“, dass die Angst der Sowjetbürger vor der Obrigkeit, nach der Erfahrung der Kollektivierung und nach den Repressionen der Stalinzeit tief verwurzelt, größer war als die Angst vor der Strahlung.
Trotz des Nebelschleiers, der in meiner Wahrnehmung über diesen Tagen liegt, kann ich mich gut an sie erinnern. Ich erinnere mich an den ersten Regen über Homel’ einige Wochen nach dem Unglück. Man erzählte sich, die Wolken wurden bis dahin mit Spezialflugzeugen aufgelöst und mit Reagenzien behandelt, um radioaktiven Niederschlag zu vermeiden. Nach dem ersten, ungebremsten Regen säumten orangefarbene Ringe die Pfützen, wie man sie noch nie zuvor gesehen hatte. Die einfache Erklärung dafür lautete, das sei Blütenstaub, beispielsweise von Kastanien. Warum hatte man den früher nie bemerkt? Das Orange, die Farbe der Strahlung, war wohl kein Zufall, mit diesem Gefahrensignal warnte die Natur die Menschen. Die ganze Stadt leuchtete vor „Blütenstaub“, alle Schlaglöcher wiesen diesen Saum auf, dem man auswich, als strahlten diese Flecken tatsächlich.
In die Zone fuhr ich zum ersten Mal Ende Mai, als die zweite Umsiedlungswelle begann. Auch in den mir vertrauten Kreis Chojniki, ins Dorf Kažuški. Wieder fallen mir zuerst Nebel und Staub ein. Es war windstill, der Staub hing einfach als trüber, graubrauner Nebel träge in der Luft, als hätte man gerade eine Herde Kühe durchs Dorf getrieben. Aber die Kühe waren in den Stall gesperrt, wo sie schon seit Tagen standen, fast ohne Futter und mit prallen Eutern. Kinder und Frauen, darunter die Melkerinnen, hatte man als erste evakuiert, und nun saß der Kolchosvorsteher verzweifelt in seinem Büro und wusste nicht ein noch aus. Er hatte seit Tagen nicht geschlafen, blickte mich nur aus geröteten Augen an und verstand nicht, was ich von ihm wollte.
Auch ich war wie benebelt und nahm alles nur undeutlich wabernd wie durch einen Schleier wahr. Im Nachhinein kann ich mir diesen Zustand mit der Strahlenbelastung erklären. Ich war nur einige Stunden dort, der Kolchosvorsteher lebte hier. Wir saßen in seinem Büro, und er zeigte mir ein Strahlenmessgerät, das ihm die Soldaten dagelassen hatten, einen Kasten, einen Koffer mit einem Zählrohr von der Form eines Hockeyschlägers und mehreren Fenstern mit zuckenden Zeigern. Wie das denn zu bedienen sei, fragte er mich oder sich selbst, was es anzeige und ob man diese Zahlen, die Ausschläge mit tausend oder zehntausend multiplizieren musste, um den tatsächlichen Wert zu bekommen. Schon damals hieß es, die Messgeräte seien alle frisiert, um „die Leute nicht verrückt zu machen“. Später gab es dann die wohl auch nur ungenauen, aber handlicheren Piepsgeräte, aber damals . . . Damals kamen unaufhörlich besorgte, verzweifelte Dorfbewohner mit Hilfegesuchen ins Kolchosbüro. Und wo sollte der Kolchosvorsteher mit seinen Sorgen und seiner Verzweiflung hin?
Ich habe damals nichts geschrieben, keine Reportage und auch keinen Artikel. Ich habe bis heute kaum eine Zeile über Tschernobyl geschrieben. Ich kann nicht.
Aber mit dem Tod meiner Eltern im vergangenen Jahr ist eine wichtige Brücke zu meiner Heimat abgebrochen. Ich kann jetzt nur noch ihre Gräber besuchen. Vielleicht habe ich deshalb nun den Mut aufgebracht, über den ersten Monat nach Tschernobyl zu schreiben, ohne weiterzuschauen, ohne auf die jüngere Geschichte einzugehen. Damit will ich es auch bewenden lassen.
Doch selbst von diesem einen, ereignisreichen Monat ist so vieles unerwähnt geblieben. Der Besuch der hohen Parteiführung, des ersten Sekretärs des ZK der KPB Nikolaj Sljun’kov in der „Zone“. Lange danach sprach man in der Region noch von seinen Wechselschuhen und von den Kleidern, die er anzog, als er aus dem Auto stieg und beim Einsteigen wieder auszog und anschließend wegwarf. Nur die Parteibonzen glaubten, die Menschen hier bekämen nichts mit und hätten keine Ahnung. Die leidgeprüften Belarussen hatten einfach gelernt, schweigend zu dulden.
Der sowjetische schöne Schein, immer war alles gut und in bester Ordnung: „Der gewohnte Takt von Arbeit und Freizeit wird beibehalten, die Lage ist stabil.“ Das Fußballspiel zwischen Brahin und Chojniki, das für das erste Wochenende nach dem Unglück angesetzt wurde und in den Nachrichten des zentralen Fernsehkanals zu sehen war. Wo sind diese Fußballer heute und wo die auf die Tribüne beorderten Zuschauer, die sich ahnungslos einer extremen Strahlenbelastung aussetzten, die Gesundheit und Leben riskierten?
Der gemeinsame Besuch des Volksdeputierten und Nationalschriftstellers Ivan Šamjakin, bis kurz vor dem Unglück noch Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjet der BSSR, mit seinen Kollegen und Landsleuten Barys Sačanka und Mikola Mjatlicki. Vielleicht war es ihnen nicht einmal bewusst, aber ihre Wanderung in die „Unglückszone“ war Teil der Systempropaganda zur Beruhigung der betroffenen Bevölkerung. Wenn solch ehrenwerte Herrschaften keine Angst hatten, hierher zu kommen, dann konnte das alles ja so schlimm nicht sein . . .
Die Evakuierung aller Frauen mit Säuglingen, aller Schwangeren, aller Kinder im Vorschulalter und schließlich aller Schulkinder aus den Gebieten um die Sperrzone. Nur die in Haushaltsdingen völlig unbedarften Männer blieben in den Städten und Dörfern zurück. Das ist Stoff für Romane. Und wie diese „vorübergehend umgesiedelten“ Ehefrauen und Kinder notdürftig in nicht beheizbaren Pionierlagern (Vergleiche mit Konzentrationslagern wurden laut) und Kurhäusern im ganzen Land einquartiert wurden, hungrig, frierend, krank, verstört. Und wie sie von den Menschen in den sogenannten „sauberen“ Gebieten ausgegrenzt und als „Tschernobyl-Igel“ geschmäht wurden. Wer wird das je beschreiben?
Und die sogenannte „Desaktivierung“ der verstrahlten Dörfer und Städte? Was wurde da in einem Monat an Geld, Gesundheit und, ja, Menschenleben verschleudert . . . Die aus der gesamten UdSSR zusammengezogenen „Partisanen“ – so wurden die einberufenen Reservisten genannt – trugen in der 30-km-Zone von Hand, mit Spaten den Erdboden ab und „begruben“ ihn dann, deckten die Dächer neu und wuschen Asphalt und Hauswände mit Seifenwasser aus Feuerwehrschläuchen. Nicht selten vergaßen die Verantwortlichen sie einfach, sie arbeiteten hungrig und fern von ihren Familien. Und die „desaktivierten“ Dörfer wurden wenige Wochen später ebenfalls evakuiert und vergraben.
So sehen meine ganz persönlichen Erinnerungen an den ersten Monat nach der neuen, der Post-Tschernobyl-Zeitrechnung aus, die am 26. April 1986 um 1 Uhr 23 Minuten 40 Sekunden einsetzte. Aber es sind nicht nur meine Erinnerungen, denn selbst nach offiziellen Statistiken sind von Tschernobyl 23 Prozent der Landesfläche von Belarus oder 47 000 km² betroffen, mit 3678 Dörfern und Städten, in denen mehr als eine halbe Million Menschen lebten. Also hätte praktisch jeder Belarusse Ähnliches zu berichten, weil jeder seine Sorgen und Erinnerungen aus jenen ersten Wochen mit sich herumträgt.
Tschernobyl hatte in erster Linie Konsequenzen für die Belarussen und, etwas weniger, für die Ukrainer, so die gängige Meinung. Und was ist mit den Westeuropäern? Und dem Rest der Welt? Geht sie das etwa nichts an? Vielleicht haben sie auch noch nie vom Chronischen Erschöpfungssyndrom gehört?
Wie geht es weiter, wenn die Halbwertszeit von Cäsium und dann auch Strontium abgelaufen ist? Darüber will die Menschheit lieber nicht nachdenken, sie hat auch so schon Sorgen genug. Sie kümmert sich jetzt eher um die „globale Erwärmung“. Da fließen die Geldströme. Und was ist schon mit Tschernobyl zu holen? Vielleicht ein bisschen „Extremtourismus“ in den evakuierten, mittlerweile halb zerfallenen Städten und Dörfern, in denen noch heute die Hektik und Brutalität des abrupten Aufbruchs und der konservierte Geist der untergegangenen UdSSR zu besichtigen sind; Fahrten zu den „nicht ausgesiedelten“ Wäldern, Wiesen, Flüssen und Seen mit ihren „nicht ausgesiedelten“ Wölfen, Elchen, Hasen, Igeln, Schlangen und Fröschen. Diese Art des „Tourismus“ könnte noch ein wenig Geld bringen, alles andere kostet: Sanierungsmaßnahmen, „Desaktivierung“, Behandlung der Folgekrankheiten . . .
Und wozu Geld ausgeben? Das geht doch uns in Rom, Paris und Stockholm nichts an. Das ist doch weit weg, in irgendeinem weißen Russland. Und in Minsk denkt man genauso: nicht bei uns, sondern weit weg, wo liegen denn Brahin und Chojniki, Vetka und Naroŭlja? Ob in der Hauptstadt oder in der „Tschernobyl-Zone“ selbst, überall scheint das Strahlungs-Thema nur noch Frustration auszulösen, es besteht ja doch keine Hoffnung, dass sich noch etwas ändert.
Anscheinend sind wir noch nicht tot – von dieser Gleichgültigkeit gegen uns selbst, gegen unsere Nächsten, unsere Nachkommen, unsere Heimat und unsere Erde einmal abgesehen. Sorglos und fahrlässig leben wir dahin, ohne an die Zukunft zu denken. Aber nein, wir leben längst nicht mehr, wir existieren bloß noch. Wir sind längst nicht mehr gleichgültig, wir sind gefühlstot.
P. S. Dieser Text ist mir schwergefallen. Er hat mich über zwanzig Jahre gekostet. Mehrmals habe ich angefangen und nach ein paar Zeilen wieder abgebrochen. Denn ich wollte nur erzählen, was ich selbst erlebt habe, keine Tschernobyl-Reportage mit Inhalten aus anderen Büchern oder dem Internet verfassen. Und nur über persönliche Dinge zu schreiben, ist immer schwer.
Die Unsicherheit und Ungewissheit, die sich durch den gesamten Text ziehen, lassen mich immer wieder zweifeln, ob er überhaupt gedruckt werden sollte. Denn so wie damals bei uns rein äußerlich nichts geschehen ist, geschieht auch in diesem Text nichts, so unverständlich wie die Tragödie damals war, bleibt auch dieser Text. Eine Art Tagebuch der Ereignisse ist entstanden, aufgezeichnet mit über zwanzig Jahren Abstand.
Bleibt zu hoffen, dass die Erinnerung an jene Ereignisse auch das Gedächtnis anderer in Gang bringt, dass auch sie sich wieder an den heißen, regenlosen, staubigen, sturmtrockenen April erinnern, an die Desaktivierung, die Tschernobyl-Aussiedler . . .
Sicher sind viele Empfindungen inzwischen stumpf geworden, die Grundstimmung ist aber die alte. Wir haben damals nicht verstanden, was Tschernobyl uns gebracht hat, und wir können die tragischen Konsequenzen auch heute noch nicht vollständig ermessen. Die Strahlung ist etwas Furchtbares, sie tut nicht weh, sie tötet unauffällig und in aller Stille. Gedächtnislosigkeit ist etwas Furchtbares – auch sie tötet still. Nicht einzelne Personen, sondern eine Nation.
Eine ganze Nation . . .
Erst eine Nation und dann die gesamte Menschheit?
Aus dem Belarussischen von Thomas Weiler, Karlsruhe
Volltext als Datei (PDF, 137 kB)