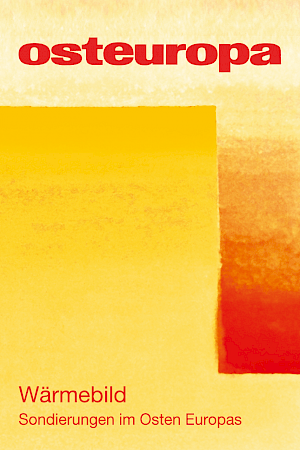Das Zeugnis der Toten
Jurij Dmitriev, Wanderer im Archipel
Volltext als Datei (PDF, 1 MB)
Abstract in English
Abstract
Im Jahr 1997 entdeckte der Historiker Jurij Dmitriev in einem Waldstück bei Medvežegorsk ein Massengrab aus den Jahren 1937/38. Seither hat er zahlreiche Tote identifiziert und die Namen von Tausenden von Opfern des Stalinterrors veröffentlicht. Dank seiner Bemühungen entstand an dieser Stelle die Gedenkstätte von Sandarmoch, die jedes einzelne Opfer würdigt. Dmitrievs akribische Arbeit ist von großer Bedeutung für das Verständnis der Vergangenheit in Russland. Seine Arbeit wurde jedoch durch eine systematische Kampagne gegen ihn unterbrochen. Seit Dezember 2016 befindet er sich unter offenkundig falschen Anschuldigungen in Haft.
(Osteuropa 9-10/2017, S. 3–15)
Volltext
Sergej Lebedev
Das Zeugnis der Toten
Jurij Dmitriev, Wanderer im Archipel
Die Gabe
Es gibt Schicksale, die ungewöhnlich wirken, aber bei genauerer Betrachtung sieht man: Mit dieser Aufgabe hätte auch ein anderer fertig werden können.
Und es gibt Schicksale, die genau auf eine Person zugeschnitten scheinen: An dieser Stelle kann man sich unmöglich jemand anderen vorstellen.
So ein Fall ist Jurij Dmitriev.
Die Journalisten nennen ihn Chottabyč, manchmal auch Gandalf.[1] Anfangs klingt das lustig und treffend, aber irgendwann wird es zuviel, man hat den Eindruck, dass die, die das schreiben, nicht recht wissen, was sie mit ihm machen, in welches Regal sie ihn einsortieren, wie sie ihn beschreiben sollen.
Worum es bei Dmitriev geht, ist das Gute – und noch etwas anderes, Überirdisches; auf Fotos von früher, vor der Verhaftung, sieht er wirklich wie ein Zauberer aus – ein Samson, dem sie im Gefängnis die Haare abrasiert haben, um ihm seine Kraft zu rauben.
Trotzdem meine ich, dass Dmitriev ein rationaler Mensch ist, der weiß, was zu tun ist. Wie jener Chef eines längst geschlossenen Flugplatzes in Komi, der viele Jahre lang die Landebahn sauberhielt, auf der dann eines Tages eine Tu-154 notlandete. Solche Menschen sind selten, man bemerkt sie kaum, aber ohne sie käme das Leben zum Stillstand. Vor allem aber haben sie nichts Mystisches oder Magisches an sich, sie besitzen vielmehr einen präzisen Verstand – und eine ganz bestimmte Gabe.
Suchen. Für alle, die mit dem Norden zu tun haben, hat dieses Wort eine besondere Bedeutung. An einschlägigen Hochschulen gibt es sogar eigene Lehrstühle, an denen man das Suchen lernt, das Erkunden, die „Prospektion“.
Suchen ist ein Beruf und eine Begabung, in der Geschick und Glück mit einem sechsten Sinn zusammenkommen, einem intuitiven Wissen darum, dass man nicht das Fundstück findet, sondern den Weg dorthin, und das nicht nur im wörtlichen Sinn des Fußwegs durch die Taiga.
Ich kenne diese Gabe des Suchens aus der Geologie. Die interessantesten Minerale finden sich immer am Übergang, dort, wo verschiedene Gesteinsarten aufeinandertreffen, und es kommt darauf an, dass man ein Gespür entwickelt für diese Kontaktzonen in der Landschaft, die sich immer ein bisschen abheben, sich unterscheiden vom benachbarten Gestein.
Eine andere Spielart dieser Gabe ist der makabre Spürsinn der Suchtrupps beim Wach- und Rettungsdienst, ihr Gefühl für Unglücksorte und lebensgefährliche Konstellationen. So ein Erkunder kann fühlen, vermuten, vorhersagen, an welcher Stelle und auf welche Weise eine Gruppe verunglückt ist. Nur so kann man sie finden: Die Taiga ist groß.
Jurij Dmitrievs Gabe ist von dieser Art. In ihm vereint sich das Wissen des erfahrenen Archivars mit kriminalistischer Beharrlichkeit und dem feinen Gespür eines Kenners der Taiga.
Diese Gabe ist eine Berufung zum Suchen und zugleich eine schmerzliche Besessenheit von ihr, sie kommt oft allzu geradlinig und keinen Widerspruch duldend daher; man kann sie nicht abschalten, sublimieren, auf etwas anderes umlenken.
Die Menschen, die sie besitzen, sind wandelnde Radargeräte; jeder von ihnen ist auf etwas Eigenes eingestellt, auf eine bestimmte Welle, einen Stoff, eine Spur.
Im Alltag ist es manchmal nicht einfach mit ihnen: Die Begabung gibt nicht nur, sie nimmt auch. Diesen Menschen ist Wichtiges unwichtig und Offensichtliches unverständlich; sie können nicht aufhören, können ihre Gefühle und Handlungen nicht dosieren, sie sind total – und in manchen Dingen so blind wie in anderen scharfsichtig, weitsichtig, hellsichtig.
Doch genau diese Leute sind die legendären Gestalten des Nordens, die Helden der Zunft und der lokalen Überlieferung, und mit ihrem Talent zum Finden sind genau sie es auch, die die kleinen, verstreuten Welten des Nordens zu einem Ganzen zusammenfügen. Die ortskundigen Sucher und Finder sind die ersten Agenten der Zivilisation, sie sind es, die Wege bahnen. Jurij Dmitriev richtet die Zivilisation dort wieder auf, wo sie in kranker, antizivilisatorischer Form, in Gestalt des GULag schon einmal war und ihre verborgenen Geschwüre hinterlassen hat: die namenlosen Lagergräber.
Der Kartograph
Bei einer Expedition im nördlichen Ural stießen wir einmal auf eine Generalstabskarte im Maßstab 1:100 000, auf der Bäche und Flüsse mit seltsamen Namen verzeichnet waren: Alfaschor, Betaschor, Gammaschor, und so weiter bis Omegaschor. „Schor“ ist das Komi-Wort für Bach, die griechischen Buchstaben dagegen entsprangen der Phantasie der sowjetischen Topographen, die es offenbar satt hatten, sich Namen wie „Schneller“ oder „Langer Fluss“ auszudenken. Mich frappierte damals, dass man einfach ein Stück Land nehmen und für einen banalen Scherz benutzen kann, als wäre es ein Stück Papier. Man kann da einfach irgendetwas draufschreiben, und der Raum wie das Papier lassen es sich gefallen, denn die indigenen Einwohner haben keine Befehlsgewalt über die Karten, ihre Toponyme, ihr in den Namen kodiertes Langzeitgedächtnis sind nicht kompatibel mit der Geschichte des Staats, es gelingt ihnen nicht, in den allgemeingültigen Namen, Erinnerungen und Symbolen in Erscheinung zu treten, oder der Zugang dazu wird ihnen verwehrt.
Warum ist mir diese Episode im Zusammenhang mit Jurij Dmitriev wieder eingefallen? Weil auch er den Raum kartiert. Was er tut, hat nicht nur symbolische Qualität, wie ein Demiurg arbeitet er mit dem Leben selbst, mit dem auf der Karte ausgebreiteten Körper des von den sowjetischen Machthabern überschriebenen Landes. Er holt nicht so sehr die alten Namen zurück, er schafft neue Namen, Chronotopoi des Tragischen, die zu Gedächtnisorten werden. Die NKVD-Kommandos haben die Lagerhäftlinge an einem namenlosen Abschnitt der Landstraße von Medvež’egorsk nach Povenec erschossen, in einem unscheinbaren Waldstück. Aber Dmitriev hat die Gräber entdeckt und den nächstgelegenen Flurnamen in Erfahrung gebracht – seither gibt es Sandarmoch.
Das ist ein äußerst wichtiger Schritt. Die Lager im Norden, ob in Karelien, Vorkuta, Noril’sk, auf Kola, an der Kolyma und anderswo, dieses ganze Netz nomadisierender, den geförderten Bodenschätzen hinterherziehender Außenlager, existierte bis auf wenige Ausnahmen nicht in der Geschichte, sondern in der nackten Geographie. Die Geschichte ist in Gestalt der Lagerbaracke in diese Gebiete eingezogen, aber die Baracke stand nicht auf historischem Grund, darunter gab es keinerlei Kulturschicht, und weit und breit lag kein kulturelles Wegzeichen, an dem man die Erinnerung hätte festmachen können.
Als die Lager geschlossen wurden, kehrte die Gegend zu ihrer natürlichen Daseinsform zurück, zur selbstverständlichen Amnesie der Natur, die alle Zeugnisse vernichtet: Die Baracken verfaulten, die Brücken wurden fortgespült, die Straßen vom Wald verschluckt, die Erschießungsgräben füllten sich mit Erde, verschwanden unterm Moos.
Dieser Raum des Nordens, dessen Genealogie erst mit dem Lager beginnt, leistet der Historisierung hartnäckigen Widerstand, denn er sinkt auf Schritt und Tritt in sein früheres Nichtsein zurück, in den Halbschlaf von Flüssen und Wäldern. Dmitriev macht aus diesem ursprünglichen Nichts ein Etwas, er erschafft die Punkte, um die herum Erinnerung keimen und sich kristallisieren kann.
Wanderer im Archipel
Nachdem der Expeditionshubschrauber abgeflogen ist, dauert es eine Woche, dann beginnt die Erinnerung an die Stadt, an das große Land, das man in der Ferne hinter Taiga und Bergen zurückgelassen hat, zu verblassen. Nach einem Monat schaut man seinen Reisepass an und wundert sich – was ist das nochmal, was macht man damit? Nach sechs Wochen fallen ungenutzte Eindrücke weg, Gerüche und Klänge, die in der Umgebung keinen Widerhall finden. Einmal versuchten wir uns abends im Zelt zu erinnern, wie eine Orange riecht – es gelang uns nicht, statt einer Geruchsvorstellung fanden wir nur deren leere Schale.
Auch das Umgekehrte trifft zu: Ich habe oft bemerkt, dass Menschen aus Zentralrussland den Norden nicht als Teil ihrer inneren Heimat empfinden, sie haben kein Gefühl für ihn. Der Norden, das ist irgendwo weit weg, man kennt ihn aus Liedtexten, komm mit mir in die Tundra … das Flugzeug trägt uns übers grüne Meer …
Die nationalsozialistischen Lager sind tief in die deutsche und polnische Landschaft eingeschnitten und mit ihr verschmolzen, sie lassen sich schon aus ihrer Geographie nicht entfernen. Sie sind hier, ganz in der Nähe, in einer Stunde mit dem Zug erreichbar, in zwei mit dem Bus – ganz nah bei Berlin, bei München, einen Katzensprung von Weimar, Krakau, Warschau.
Die Stalinschen Lager dagegen vergisst man leicht – ihre Überreste wurden abgerissen, als man in den sechziger Jahren Städte und Industriezonen ausgebaut hat, oder sie liegen in einem diffusen Anderswo, unweit der Abstraktion namens Polarkreis, dem Blick und der Erinnerung entzogen.
Die endlosen Räume des russischen Nordens, Sibiriens, Kasachstans waren wie eine Geländefalte, eine „Tasche“, in der man Millionen von gewaltsam entwurzelten, ihrer gewohnten Umgebung, ja ihrem Erinnern als solchem entrissenen Menschen verschwinden lassen konnte. Es ist kein Zufall, dass man im Norden den Rest des Landes „das Festland“ nennt; der Norden selbst dagegen erscheint als genau jener Archipel, von dem Solženicyn gesprochen hat, als undefinierte Peripherie, oder – auf einem Nachtflug nach Magadan aus dem Flugzeug gesehen – als Raum der Finsternis.
Ein zweifacher Tod
Die Millionen von Gefangenen, die in den Lagern ermordet wurden oder umkamen, starben nicht einfach nur fern ihrer Familien. Ihr Tod fand statt als Eintrag in die Rechenschaftsberichte der Lagerverwaltungen und als physisches Ereignis, aber er fand keinen Eingang in ein gemeinsames Totenbuch, in jenes zarte, sich selbst webende Geflecht des unter den Lebenden verteilten Gedenkens, das von einer Vielzahl einander ergänzender, sich über die Zeit tradierender individueller Erinnerungen getragen wird. Diese kollektive Erinnerung stützt sich auf und speist sich aus einer Infrastruktur des Gedenkens: Begräbnisrituale, Trauer- und Erinnerungszeremonien, vor allem aber Friedhöfe und Gräber – jene Orte, an denen die Welt der Toten und die Welt der Lebenden sich symbolisch berühren.
Im russischen Volksglauben gibt es den Begriff der „verlegten Toten“: jene, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind und nicht dem Brauch entsprechend bestattet wurden. Die „Verlegten“ finden keine Ruhe, sie sterben gleichsam nicht vollständig, sondern bleiben zwischen dieser und der anderen Welt hängen, sie erscheinen den Lebenden und fordern ein ordentliches Begräbnis und Erlösung für ihre Seele.
Die Toten des GULag – viele von ihnen sind im nördlichen Permafrostboden auch physisch unverwest – sind im Grunde genau solche „verlegten“ Toten. Man hat ihnen nicht nur das Leben, sondern auch den Tod geraubt – jenen kulturellen, rituellen Tod, in dem der Wert der einzelnen menschlichen Existenz und die Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele zum Ausdruck kommen und ohne den es kein Gedenken gibt.
Der enteignete Tod, die Deprivation über das Lebensende hinaus: das ist das Thema, an dem Jurij Dmitriev arbeitet.
Und es ist von großer Bedeutung, wie er das tut. Denn in Wahrheit ist alles vergebens – Bücher, Filme, Denkmäler –, wenn Friedhöfe nicht Friedhöfe heißen und wenn man den Toten nicht ihre Namen zurückgibt.
Der Mensch ist die Spezies, die ihre Toten begräbt. Ohne diese Norm fallen wir nicht nur in archaische, sondern in prähistorische Zeiten zurück, in denen der Körper des Menschen noch nicht als Gefäß der Seele galt, das einen besonderen rituellen Umgang erfordert.
Wir aber haben unsere Toten tatsächlich nicht begraben. Wir haben sie in Taiga und Tundra zurückgelassen, dort, wo die Lager des GULag standen.
Ich weiß nicht, was die Last dieser Abkehr von der kulturellen und moralischen Pflicht (um nicht zu sagen, dieses Verrats) im Einzelnen für Russlands Entwicklung bedeutet, zu welchen Komplikationen und Deformationen sie geführt hat. Ich glaube aber, dass diese Last, diese Sünde über die Maßen schwer wiegt.
Was Jurij Dmitriev mit intuitiver Präzision tut, gleicht einer Reinigung, einer Läuterung, einer Entlastung – des Lebens und Sterbens, ja des Karmas (ich benutze dieses Wort mit Vorsicht) unseres ganzen Landes.
Eigentlich nichts Besonderes, könnte man meinen – jemand hat die Stelle gefunden, an der ein Mensch getötet wurde, und an dieser Stelle befindet sich weiter nichts außer ein paar Bäumen und einem Erdhügel. Man kann sie sich leicht vorstellen, sie scheinen austauschbar. Doch diese Arbeit dient nicht einfach der Ermittlung biographischer Details, obwohl auch das Biographische wichtig ist. Es geht nicht nur um das Leben des Einzelnen, in das Licht gebracht wird, nicht nur um einen Triumph der Gerechtigkeit – obwohl von Gerechtigkeit im Sinn von Sühne eigentlich keine Rede sein kann –, sondern um die zurückgegebene Würde.
Denn der Mensch, der hier liegt, wurde ja genau deshalb wie ein Hund verscharrt, damit ihn niemand findet, damit sein Name ausgelöscht wird und er verschwindet, als hätte es ihn nie gegeben.
All das wird gewogen auf einer Waage, die mit unserem gewöhnlichen Leben wenig zu tun hat. Wenn unser aller Schicksal als Gemeinschaft von irgendwem abhängt, dann von solchen Leuten wie Jurij Dmitriev.
Der Beweis
Der Norden, Sibirien – das sind ideale Orte für ein Verbrechen. Man spürt das ab und an in der Taiga. Du weißt genau, wenn du dir jetzt ein Bein brichst, findet dich keiner mehr, oder du spürst in einem heftigen Streit plötzlich diese Versuchung – weit und breit kein Zeuge, die Taiga verbirgt alles.
Jeder Kriminalroman dreht sich um die Leiche des Ermordeten. Der Körper ist das wichtigste, das von Gott gegebene Indiz. Ein Körper ist schwer zu verstecken, er ist groß, schwer, zersetzt sich langsam. Wird er jedoch nicht gefunden, gibt es genau betrachtet kein Verbrechen, keinen Mörder.
Die Nationalsozialisten haben in ihren Lagern Krematorien gebaut. Der GULag brauchte keine Krematorien. Ein Lagerimperium in einem Raum, in dem Millionen Körper vernichtet werden konnten und für viele weitere Platz gewesen wäre.
Daher ist Dmitrievs Herangehensweise so wichtig: die Körper suchen, die Massengräber. Sich nicht mit Kenotaphen, mit symbolischen Gräbern zufriedengeben, mit musealen Konstrukten.
Nur die Körper und die Erschießungsgräben schreien die Tatsache des Verbrechens mit äußerster Kraft heraus; vermutlich ist Dmitriev genau deswegen so unbequem, so gefährlich für die heutigen Machthaber. Sie errichten ein kollektives Denkmal am Sacharov-Prospekt,[2] erkennen, wenn auch mit Einschränkungen, die Opfer der Repressionen an, doch diese Opfer sind wie losgelöst von dem ins Abstrakte gerückten Verbrechen, das an ihnen begangen wurde. Dmitriev dagegen zeigt unerbittlich, wie verbrecherisch das Stalin-Regime und generell die Sowjetmacht war, er führt einen unwiderlegbaren Nachweis, indem er die Skelette vorlegt, die Schädel mit den Einschusslöchern am Hinterkopf.
Das Schweigen der Toten
Alles, was wir über den GULag wissen, haben wir aus den Zeugnissen der Lebenden, der Überlebenden erfahren. Doch es gibt auch jene, die nie mehr etwas erzählen werden, deren Leben zu knapp bemessen war für eine Geschichte; sie sind tot, und fertig. Vielleicht spürt man nur unter dem ungemütlichen Himmel des Nordens deutlich, dass unsere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit noch eine andere, unsichtbare und sprachlose Seite hat. Die Toten haben ihre eigene Wahrheit, und diese Wahrheit der Nicht-Überlebenden ist schrecklicher als jede Erzählung eines mit dem Leben Davongekommenen.
In gewissem Sinne widerspricht diese Wahrheit jener der Überlebenden, der Zurückgekehrten. Die Toten hatten und haben keine Möglichkeit, sich zu erinnern, zu schreiben, zu verarbeiten. Ihre Welt reißt mit dem GULag ab, sie kehren nie wieder zurück, sie bleiben im Lager versiegelt.
Durch die Zeit selbst geht ein Riss. Wieder zusammenfügen, heilen lässt er sich, wenn überhaupt, nur in dem Maße, in dem diejenigen, denen die Pflicht zur Erinnerung qua Verwandtschaft auferlegt ist, bereit sind, diese Pflicht nicht an vergesellschaftete, museale Formen des Erinnerns zu delegieren, sondern die naheliegendsten, einfachsten Dinge selbst zu tun: den Ort finden, ein schlichtes Denkmal aufstellen, der Toten gedenken, familiäre und individuelle Traditionen schaffen und so die zerstörte Konjugation der Schicksale durch die Zeiten und die Geschichte wiederherstellen.
Jurij Dmitriev – dies ist ein weiteres seiner großen Verdienste – nimmt diese unumgängliche, unersetzliche Arbeit keinem ab, er bietet keine gebrauchsfertigen Erinnerungsformen an. Er bewegt die Menschen zu persönlicher Teilnahme, und zwar nicht durch Appelle oder sein gutes Beispiel, sondern allein durch die Struktur und Logik der Orte der Erinnerung, wie er sie sieht und erschafft.
Sandarmoch
Die erste Assoziation in Sandarmoch ist: Tschernobyl. Ein Ort des unsichtbaren Todes, der mit dem Wind dahinfliegt, mit dem Regen strömt. Auch in Sandarmoch herrscht ein unsichtbarer, immaterieller Tod, der nur als Lichtfleck oder Schatten präsent ist. Es ist ein Ort, an dem einem „graut vor jedem Blatt, vor jedem Vogelflügelschlag“, wie es bei Semen Lipkin heißt – in einem Gedicht, das nicht von Sandarmoch handelt und doch genau dessen eiskalten Ton trifft.[3]
Wo einem graut vor jedem Flügelschlag: Das ist Sandarmoch. In den Jahren 1937–1938 wurden hier mehr als neuntausend Menschen erschossen.
Kein Tod gleicht dem anderen. In Sandarmoch starb man unter solchen Qualen – die Hände auf den Rücken gebunden, niedergeknüppelt, auf der Ladefläche eines Lastwagens auf einen Haufen geworfen – dass es scheint, hier muss ein direkter Eingang zur Hölle gewesen sein. Als müsste an der Stelle dieser zarten Kiefern, dieser Hügel, dieser roten Tupfer der herbstlichen Preiselbeeren auf dem grauen Grund der Flechten hier ein blutendes Loch im Weltgebäude klaffen.
Ein teuflischer Ort.
Ein Ort von solch unentrinnbarem Grauen, dass er sich jeder Kultur entzieht. In gewissem Sinne ist es folgerichtig, dass es hier kein Museum gibt, keine Fotos, keine Exponate: nur Grabsteine, Kreuze, einen Glockenturm.
Sandarmoch hat seinen Weg, seine Entwicklung zu einem Museum noch vor sich, hier sind bestimmte grundlegende Dinge noch nicht geschehen, aus Chaos ist noch nicht Kosmos geworden, aus Nichtsein nicht Sein.
Es gibt einen weiteren Ort, der einem beim Anblick der Gedenktafeln in Sandarmoch einer seltsamen Reminiszenz folgend sofort in den Sinn kommt; diese auf vertraute Weise schlichten, oft geschmacklosen, den neuesten Friedhofskitsch spiegelnden Tafeln – es fehlen nur die biederen Amateurfotos mit aufgeknöpftem Jackett – erinnern an etwas ganz Bestimmtes.
Genau solche Bilder säumen mittlerweile auch den Soldatenfriedhof auf dem Mamaev-Hügel in Volgograd. Es ist, als hätten sie an der Stilgrenze des sowjetischen Ensembles haltgemacht, würden sie nicht überschreiten, jedoch hinüberblicken. Die von nationalen Gemeinschaften sowie von Bürgermeistern, Gouverneuren oder Republikspräsidenten aufgestellten Gedenktafeln versuchen, den Stahlbeton des sowjetischen Gedenkkomplexes, der nichts Individuelles zulässt („hier gibt es kein einzelnes Schicksal, hier sind alle in eins verschmolzen“, sang einst Vladimir Vysockij[4]), zu sprengen und für die angereisten Nachkommen einzelne, zum individuellen Erinnern geeignete Stücke herauszubrechen.
Dmitriev und seine Mitstreiter hatten die kluge und richtige Einsicht, dass es in Sandarmoch kein allgemeines Denkmal geben darf, das die Aufmerksamkeit auf sich zöge und Gefahr liefe, zum Gegenstand unreflektierter Verehrung zu werden.
Als Gedenkort ist Sandarmoch auffallend zersplittert; auf den ersten Blick scheint ein zentrales Denkmal hier sogar als Desiderat. Doch dann versteht man, dass gerade seine Abwesenheit das Entscheidende ist.
Sandarmoch entwickelt sich und gewinnt an Bedeutung als Summe individueller Erinnerungsakte, individueller Suchbewegungen; ich würde sogar sagen, dass Sandarmoch reift, sich langsam seiner selbst, seiner Bedeutung bewusst wird; der Ort reinigt sich, er wird gleichsam geläutert durch die Fürbitten – und damit sind nicht nur Gebete gemeint –, durch die persönlichen Anstrengungen der überlebenden Angehörigen, die diesen Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens als sehr konkreten Erinnerungsort herrichten: nicht irgendwo, sondern genau hier, hinter diesem Waldstück, hinter dieser Biegung, hinter dieser Kiefer, bei diesem moosüberzogenen Findling.
So entsteht eine Art Gemeinschaft von Sandarmoch, eine Gemeinschaft der Erinnernden und Anteilnehmenden, in der niemand das Monopol auf Erinnerung hat (anders als in Butovo zum Beispiel, wo die Russisch Orthodoxe Kirche das Sagen hat und der christliche Märtyrerkult eindeutig im Vordergrund steht).[5]
Geschichte und Zukunft von Sandarmoch könnten ein Modell für die Entwicklung Russlands sein. Wir brauchen eine erneuerte Gemeinschaft – einen Verbund von Gemeinschaften – von Nachkommen der unter Stalin Ermordeten, die bereit sind, die Verantwortung für die Erinnerungsorte, ja für die öffentliche Erinnerung in allen ihren Formen auf sich zu nehmen. Doch dies ist keine Aufforderung an Jurij Dmitriev, sondern an uns, die wir ihm auf dem Weg folgen, den er gebahnt hat.
Die Erschießungsgräben in Sandarmoch sind mit Plastikblumen markiert. Und plötzlich wird klar, dass man diese Blumen auf zweierlei Art betrachten kann: als Zeichen des Gedenkens – und als rote Fähnchen, wie man sie benutzt, um einen gefährlichen Ort zu kennzeichnen, ein Wasserloch, eine Einsturzstelle: Vorsicht!
Und wieder kommt einem beim Gedanken an Sandarmoch und Dmitriev Tschernobyl in den Sinn, mit seinen Liquidatoren, die den Reaktor „gelöscht“ und die stärkste Strahlung auf sich genommen haben.
Es gibt radioaktive Elemente mit kurzer Halbwertszeit, und solche, die erst in Jahrhunderten, Jahrtausenden zerfallen.
Auch wir haben diese Langzeitstrahlung zu beseitigen, den vom GULag kontaminierten Raum zu säubern und bewohnbar zu machen.
P.S.
Ich stehe am Leningrader Bahnhof und rauche. Der Zug nach Petrozavodsk geht in einer halben Stunde. Morgen findet eine weitere Gerichtsverhandlung statt.
Eine Frau läuft hektisch herbei:
- Junger Mann, wollen Sie vielleicht eine Arbeit als Aufseher?
Ich lehne ab.
Sie fragt andere Männer und spricht gleichzeitig am Telefon:
- Ich sag doch, nein … Er hat gesoffen. Morgen ist Schichtwechsel und es ist keine Ablösung da, weil der Mistkerl seinen Rausch ausschläft.
Plötzlich überkommt mich eine seltsame Dankbarkeit für diesen unbekannten Menschen, der sich dem Suff hingegeben hat und morgen nicht auf seinem Posten erscheinen wird, um den Schlagbaum zu öffnen, die Namen und Passnummern der Besucher zu notieren.
Es gibt zu viele von diesen Aufsehern und Bewachern in letzter Zeit. Welch ein Glück, dass die Geschichte von Sandarmoch rechtzeitig begann, dass Dmitriev diesen Ort schon 1997 entdeckt hat. So hatte er einige Jahre Zeit, um Gestalt anzunehmen, sich zu ereignen, zu festigen – und heute lässt sich Sandarmoch nicht mehr durchstreichen oder wegwischen.
Es ist frappierend, welche Anstrengungen unternommen werden, um Jurij Dmitriev im Gefängnis verschwinden zu lassen. Gemessen an den eingesetzten Mitteln und dem Aufwand, mit dem Beweise fingiert werden, wirkt es, als wären wir nicht Zeuge einer Kampagne gegen einen Historiker, einen GULag-Forscher, sondern einer Hetzjagd auf einen Journalisten, einen Aktivisten, der ein erst vor kurzem begangenes Verbrechen aufgedeckt hat. Als läge dieses Verbrechen nicht achtzig Jahre zurück, sondern höchstens fünf oder zehn, und als hätten diejenigen, die Dmitriev hinter Gitter gebracht haben, unmittelbaren Anteil daran.
Vielleicht ist dies das Beklemmendste an dem Verfahren gegen Dmitriev: Es misst gleichsam nach, wie nahe – mit der Hand zu greifen! – die lang zurückliegenden Massenmorde uns noch sind, der Abstand zwischen 1937 und 2017 schmilzt zusammen. Es zeigt sich, dass das Jahr Siebenunddreißig in einem ewig gegenwärtigen, unentschiedenen, ungelösten Zustand verharrt, als sei es in einer Zeitschleife, einer Schlinge hängengeblieben. Wie die Nachgeborenen mit ihren im Lager umgekommenen Angehörigen, so sind auch Russlands heutige Machthaber durch Blutsverwandtschaft, Wesensverwandtschaft mit den Henkern und Mördern der Stalinzeit verbunden und können sich kraft dieser monströsen Verwandtschaft nicht von ihnen lossagen.
Es ist kein Zufall, dass man in diesem Verfahren die Handschrift des Ressorts mit den drei Buchstaben wiedererkennt. Es war dasselbe Ressort, das den Dissidenten Drogen unterschob, ihnen Vergewaltigungen und Devisenspekulation anhängte. In der Diktion der Staatssicherheit der DDR hieß dies „Zersetzung“. Die geheimen Handlungsanweisungen der Stasi sind heute veröffentlicht. In der Richtlinie zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge vom 1. Januar 1976 werden die nach Ansicht des MfS wirksamsten Methoden der Zersetzung aufgezählt:
-
systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des Ansehens und des Prestiges auf der Grundlage miteinander verbundener wahrer, überprüfbarer und diskreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und damit ebenfalls diskreditierender Angaben;
-
zielstrebige Untergrabung von Überzeugungen im Zusammenhang mit bestimmten Idealen, Vorbildern usw. und die Erzeugung von Zweifeln an der persönlichen Perspektive;
-
Erzeugen von Misstrauen und gegenseitigen Verdächtigungen innerhalb von Gruppen, Gruppierungen und Organisationen;
-
die Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, Telegramme, Telefonanrufe usw., kompromittierender Fotos, z.B. von stattgefundenen oder vorgetäuschten Begegnungen;
-
die gezielte Verbreitung von Gerüchten über bestimmte Personen einer Gruppe, Gruppierung oder Organisation.[6]
Diese Aufzählung liest sich wie ein exakter, lückenloser Bericht über das, was Jurij Dmitriev widerfahren ist.
Einem Menschen, der an unser aller Rettung arbeitet.
Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja und Volker Weichsel, Berlin
[1] Šura Burtin: Delo Chottabyča. Ėkspert online, <http://expert.ru/russian_reporter/2017/08/delo-hottabyicha>. Chottabyč ist die zentrale Figur der sowjetischen Märchenerzählung Der Alte Chottabyč von Lazar’ Lagin, in dem ein junger Pionier in einem Krug den wundertätigen Dschinn Gassan Abdurachman ibn Chottab findet. Die Erzählung erschien in zwei Fassungen 1938 und 1955, bekannt ist vor allem die Verfilmung von 1956. Gandalf ist in der Lieder-Edda der nordischen Mythologie ein Zwerg und eine Hauptfigur in Tolkiens Herr der Ringe – Red.
[2] Am 30.10.2017 wurde in Moskau an der Kreuzung Sacharov-Prospekt/Gartenring ein „Denkmal für die Opfer der politischen Repressionen in der UdSSR“ eingeweiht. Es handelt sich um eine „Mauer des Trauerns“ (Stena skorbi), ein dreißig Meter hohes Bronzerelief des Bildhauers Georgij Franguljan. Die Reden hielten Präsident Putin, der Patriarch der Russischen Orthodoxen Kirche Kirill und der Abgeordnete des Föderationsrats Vladimir Lukin in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der „Stiftung Erinnerung an die Opfer der politischen Repressionen“. – Red.
[3] Semen Lipkin: Koljučee kruževo (1961): „I kakaja šamanskaja mistika / Uspokoit serdca / Tam, gde žutko ot každogo listika, / Ot poleta ptenca.“
[4] Aus dem Lied Bratskie mogily (Soldatengräber) von 1964. – Red.
[5] Auf dem ehemaligen NKVD-Schießplatz Butovo (Butovskij Poligon) bei dem Dorf Drožžino südlich von Moskau erschossen NKVD-Kommandos zwischen August 1937 und Oktober 1938 mehr als 20 000 Menschen. In den Jahren danach, als keine Massenerschießungen mehr stattfanden, wurden auf dem Gelände weiterhin erschossene Opfer des Stalin-Regimes in Massengräbern verscharrt. Erst Anfang der 1990er Jahre wurde auf Betreiben des ehemaligen Kolyma-Häftlings Michail Mindlin (1909–1998) der Ort einer kurze Zeit zuvor bekanntgewordenen Erschießungsliste zugeordnet. Mitte der 1990er Jahre ging das gesamte Gelände in den Besitz der Russischen Orthodoxen Kirche über; siehe dazu: Margarete Zimmermann: Die Russische Orthodoxe Kirche als erinnerungspolitischer Akteur (1995–2009). Der Schießplatz Butovo als Fallbeispiel für die postsowjetische Gedenkkultur, in: Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz (Hg.): Sowjetische Verbrechen und russische Erinnerung. Orte – Akteure – Deutungen. München 2014, S. 59–90. – Red.
[6] Evgenija Lëzina: Juridičesko-pravovaja prorabotka prošlogo GDR v ob”edinennoj Germanii, in: Vestnik obščestvennogo mnenija, 2/2013, S. 67–100; deutsch zitiert nach der von der Stasiunterlagenbehörde (BStU) veröffentlichten MfS-Richtlinie Nr. 1/1976.
Das russische Original unter:
www.colta.ru/articles/society/16126
Volltext als Datei (PDF, 1 MB)